Ostdeutscher zu sein ist ein Label, das an einem klebt, das man nicht los wird, selbst wenn man sich bemüht.
Es ist ja kein Geheimnis, dass ich schnell lese – und auch keines, dass ich, wenn ich ein gutes Buch in der Hand habe, die Welt um mich herum vergessen kann. Aber dass ich ein Buch um 15:00 Uhr kaufe und um 18:15 Uhr ausgelesen fortlege ist dann doch wohl eher die Ausnahme.
Ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt schon – es ist 18:16 Uhr – wirklich in der Lage bin, eine Rezension zu schreiben. Doch ich will es versuchen.
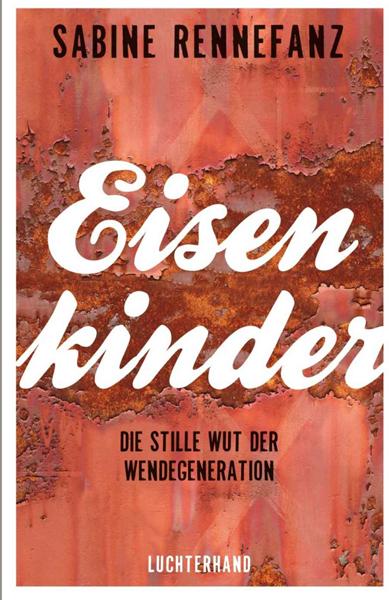 Das Buch “Eisenkinder” von Sabine Rennefanz habe ich durch ein Interview kennengelernt, dass vor einigen Tagen in der FAZ erschien. In meinem kurzen Artikel dazu schrieb ich schon: “Das Buch ‘Eisenkinder. Die stille Wut der Wendegeneration’, das der Auslöser für das Interview war, werde ich wohl lesen müssen. Denn – obschon etwas älter als die Autorin – weiß ich genau, was sie meint. Lebte ich doch nach der ‘Wende’ ebenfalls eine Weile wie im luftleeren Raum.”
Das Buch “Eisenkinder” von Sabine Rennefanz habe ich durch ein Interview kennengelernt, dass vor einigen Tagen in der FAZ erschien. In meinem kurzen Artikel dazu schrieb ich schon: “Das Buch ‘Eisenkinder. Die stille Wut der Wendegeneration’, das der Auslöser für das Interview war, werde ich wohl lesen müssen. Denn – obschon etwas älter als die Autorin – weiß ich genau, was sie meint. Lebte ich doch nach der ‘Wende’ ebenfalls eine Weile wie im luftleeren Raum.”
Ich bin gut zehn Jahre älter als Sabine Rennefanz. Das ist in dieser Zeit schon fast eine Ewigkeit. Denn ich hatte das Glück, nicht ganz orientierungslos zu sein, als sich die Gesellschaft um mich herum so grundlegend veränderte, dass es mir heute noch wie ein Wunder vorkommt, dass ich mit nur ein paar blauen Flecken davonkam. Und meine Orientierungslosigkeit mit einigen – von heut her betrachtet – seltsamen Texten und Artikeln in den Griff bekommen konnte.
Nicht so die Generation der Autorin. Die, die damals genau in der Pubertät waren; in einer Lebensphase also, in der es nichts Wichtigeres gibt als Halt zu finden. In der man auf der Suche ist nach dem, was das eigene Leben ausmacht.
Meine – ich sage mal: Tochter – war damals gerade 5 Jahre alt. Diese Generation wiederum ist kaum direkt berührt von dem Umbruch um sie herum. Sicher: auch diese Eltern haben sich mit der neuen Situation abfinden; sich darin zurechtfinden müssen. Doch das waren ja – wie ich – ein klein wenig gefestigtere Charaktere, die schon ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung hatten.
Doch zurück zur Lebensgeschichte Sabine Rennefanz’. Auslöser des Buches war – wie sie selbst im Prolog schreibt – ein Gespräch in einer Kneipe unter Kollegen. Darüber berichtet Rennefanz in einem Artikel in der Berliner Zeitung:
Wir kamen auf die Mordserie der Neonazis aus Jena zu sprechen. Doch es ging nicht nur um Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, die zehn Menschen getötet haben. Es ging sofort um viel mehr.
„Tja“, sagte ein Kollege, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, „der Osten ist halt braun.“ Eine Kollegin von einer überregionalen Zeitung stimmte ihm zu. Sie hatte auch gleich eine Erklärung. Das liege an den Familien in der DDR, an dem staatsverordneten Antifaschismus, der mangelnden Kommunikation.
Dieser Artikel dürfte als die gedankliche Geburtsstunde des Buches gelten. Denn aus den Lebenswegen der drei NSU-Täter entwickelt sie die Lebensgeschichte einer ganzen Generation. Einer Generation, die zu Opfern einer Entwicklung werden, die sie selbst nicht in der Hand haben; der sie aber ausgesetzt sind wie einer Naturkastrophe, die über sie hereinbricht.
Einige der Sätze aus dem Artikel finden sich wortwörtlich im Buch wieder – was das Buch nicht schlechter macht. Im Gegenteil. Denn eine solch klare, gerade Sprache liest man selten. Dinge werden beim Namen genannt – ungeschönt und ohne falsche Scham.
Im zitierten Artikel setzt sich Sabine Rennefanz damit auseinander, weshalb aus Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe Mörder wurden – und was sie mit ähnlicher Biografie davor bewahrte. Sie hingegen rannte anderen einfach scheinenden Ideen und Weisheiten hinterher: sie wurde für einige Jahre radikale Anhängerin einer evangelikalen Kirche. Und vielleicht kann nur jemand, der selbst im Osten des Landes aufgewachsen und sozialisiert wurde, begreifen, was hinter diesen Worten steht:
Ich ersetzte eine Religion durch die andere, mit dem Unterschied, dass ich diesmal mit vollem Herzen dabei war. Mein neuer Lenin hieß Jesus.
Wer – wie wir – in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, in der das Unwahrscheinliche als Wahrheit verkauft werden soll; in der es ein sichtbares Leben gab und eines hinter den eigenen (oder fremden) vier Wänden; in dem die Zeitungen Sieg auf Sieg verkündeten und die Strassen grau und viele Läden leer (vor allem auf dem Land; Berlin war da eine Ausnahme) waren… der begreift einen Satz wie diesen in vollem Umfange:
Wenn K. eine clevere Neonazi-Frau gewesen wäre, oder eine radikale Muslimin, hätte sie mich vielleicht ganz genauso auf ihre Seite gezogen. Der Inhalt schien fast austauschbar. Ich kam aus einer Welt, in der zwischen Gut und Böse unterschieden wurde. Man konnte nicht beides sein, man musste sich entscheiden. …
Mit diesen Mustern war ich aufgewachsen, die legt man nicht so schnell ab…
Erst im Nachhinein ergab alles Sinn. Ich fiel in eine angelernte Rolle zurück. Auch der Kommunismus funktionierte wie eine Religion, mit Merksätzen, Heiligenfiguren und einem Heilsversprechen. Das Leben war wie im Christentum auf die Zukunft ausgerichtet, auf ein Paradies, in dem alle Klassengegensätze überwunden sind.
Als die “Wende” kam, waren mir diese Schlussfolgerungen bereits Gewissheit. Ich hatte schon zuvor begriffen, dass wir in dieser kleinbürgerlichen, vermieften DDR uns immer wieder selbst belügen. Und dabei darauf stolz waren.
Ich war in der Lehre – also etwa so alt wie Sabine Rennefanz in der “Wendezeit” – und stellte die Existenz der permanent vorgebeteten “entwickelten sozialistischen Persönlichkeit” – also die der “wahren Gläubigen” – in Frage. Denn wir leben mit Menschen in einer Gesellschaft, die mit genau der gleichen Überzeugung Nazis waren wie wir Kommunisten sein sollten. Ich kannte das Wort “Opportunist” noch nicht einmal; aber ich wußte instinktiv, dass wir fast alle eben solche waren.
Denn es war schon immer einfacher, mitzutun, als Widerstand zu leben.
Und letztlich – trotz aller jugendlicher Rebellion – wir waren Teil des Systems. Das nur deshalb so lange funktionieren konnte, wie wir Teil davon waren.
Es ist sehr richtig, wenn Rennefatz davon spricht, dass die “Wende” keine friedliche Revolution war, sondern
Es war ein Zerfall. Ein Land zerfiel in seine Einzelteile. Bevor seine Bewohner sich dessen bewusst werden konnten, ich meine: wirklich bewusst werden konnten, waren sie schon zu Bürgern eines anderen Landes geworden. Etwas war zu Ende gegangen, aber nichts Neues hatte begonnen.
Und in diesen luftleeren Raum (auch diese Formulierung kommt im Buch vor und drückt genau mein Empfinden in den Jahren 1989 bis 1991 aus) wird eine Generation geworfen, deren Eltern keine Stütze, keine Hilfe mehr sein können. Denn – sein wir doch ehrlich – selbst wenn man im Alter von 16 oder 17 auf alles Mögliche hört, nur nicht auf seine Eltern – letztendlich prägen sie uns doch.
Diese Elterngeneration – die ein paar Jahre älter ist als ich – war zu jung, um sich auf’s Altenteil zurückzuziehen. Und zu alt, um noch zu lernen, die Ellenbogen zu benutzen. Eine Generation, deren Träume noch herber zerplatzten als die unserer. Sie schreibt über ihren Vater:
Als die Mauer fiel, hatte er gehofft, dass er nun mehr reisen könnte. Aber weiter als bis nach Amsterdam, 1991, ist er nicht gekommen.
Diese innere Emigration, in die sich auch meine eigenen Eltern zurückgezogen haben, kann man nicht besser ausdrücken als in dem Satz
Früher besuchten sich die Menschen gegenseitig. Jetzt saßen sie vor dem Fernseher.
Es gibt wenige Bücher, die ich so verschlungen habe. Und ebenso wenige, in denen ich mir so viel angestrichen habe.
All das, was die Autorin über ihre Zeit in der evangelikalen Kirchgemeinde schrieb, muss hier zu kurz kommen. Das aber muss ich sagen: es ist mit einer fast gnadenlosen Distanz geschrieben. Und es gibt mehr als diese nachfolgend zitierte Stelle, die Auskunft über den Irrsinn gibt, der mit den Glaubesgrundsätzen verbunden ist. In einem “Gebetskreis” fragt eine junge Frau nach, ob es in Ordnung sei, wenn sie ihrem Freund einen Blowjob gönnt.
Ruth, die Älteste, schlug in der Bibel nach und fand eine obskure Stelle in dem Lied des Salomon, in dem von einer Braut und einem verschlossenen Garten die Rede ist. Der Garten musste verschlossen bleiben, das war etwas blumig formuliert, schien aber die Frage zu beantworten. Gott hatte also nichts gegen Oralsex.
Als Missionarin verschlägt es Sabine Rennefanz in die fast menschenleeren Weiten Kareliens. Dort kommen ihr (als Leser mag man denken: endlich) Zweifel an dem, was sie tut. Es gibt kaum genug Brot – und sie und ihre Mitmissionarin kommen mit Bibeln in dieses zerrissene Land.
Die Russen wollten keinen Heiland. Sie hatten ihren Wodka…
Ich schämte mich dafür, hungrige Kinder indoktriniert zu haben… Ich fragte später, warum wir keine Lebensmittelspenden mitgebracht hatten…
Ich interpretiere viel mehr in das Buch hinein, als es vermutlich sagen will. Sabine Rennefanz beschreibt die Situation derer, die 1989/90 gerade begannen, das Leben zu entdecken. Ich sehe auch die etwas Älteren und ein wenig Jüngeren. Über die noch kein Buch geschrieben wurde.
Oft wird Uwe Tellkamps “Der Turm” nachgesagt, das Buch über das Ende des Ländchens zu sein. Ich war nie dieser Meinung. Da die DDR eben kein Staat der Intellektuellen war. Sondern der der kleinen Leute – der Kleinbürger, die sich irgendwie einrichten.
Sabine Rennefanz’ Buch füllt hier eine große Lücke aus. Eine Lücke, die vermutlich nur Jemand ausfüllen kann, der (die) mit einem gewissen zeitlichen Abstand über eine Zeit schreiben kann, die ihn (sie) prägte und der (die) dieses Loch in der Biographie empfinden konnte.
Und es gibt noch einen Satz – ziemlich am Anfang des Buches – der sich mir eingeprägt hat:
Die DDR war ein kleines Land ohne große Ressourcen, das unbedingt in der Welt anerkannt werden wollte. Als wichtigster Rohstoff galten die Menschen, es war wichtig, Talente früh zu entdecken. Auf die Herkunft kam es nicht an. Wer sich in einem Wettbewerb hervortat, wurde weiter gefördert, egal, ob man das Kind eines Lehrers oder eines Schlossers war.
Diesem Umstand habe ich zu verdanken, dass ich heute schreiben kann und davon leben – und nicht mehr in Schlosserwerkstätten an Drehbänken stehen muss. Beziehungsweise vermutlich arbeitslos wäre.
Dieses Ausbrechen war möglich. Einfacher, als es heute zu sein scheint.
Meine Zukunft im Dorf schien absehbar: Ich könnte Melkerin im Kuhstall, Verkäuferin oder Sekretärin werden, einen Traktorfahrer namens Ronny oder Maik heiraten und mit 19 ein Kind bekommen, das ich Sandy nannte.
Es war möglich, diesem vorgesehenen Leben zu entkommen. Wenn man irgendein kleines Talent hatte. Oder sich bemühte. Die Chancen zum “Aufstieg” waren kleiner – wie das ganze Land kleiner war. Aber es gab sie. Vielleicht macht auch das uns so unsicher in dieser jetzigen Gesellschaft?
Nic
PS: Ich kann bei meinen Zitaten leider keine Seitenabgaben machen da ich das Buch als eBook las.
PSS: Das Schlusskapitel des Buches ist in der ZEIT in leicht gekürzter Fassung erschienen.
PSSS: Und in der Mediathek der ARD findet sich ein Gespräch mit der Autorin – vermutlich von der Buchmesse. Hier erklärt Sabine Rennefanz auch, woher der Titel des Buches “Eisenkinder” rührt. Ich dachte dabei immer an Gundermann. Aber der Film über ihn hieß “Ende der Eisenzeit”.
Sabine Rennefanz – Eisenkinder: Die stille Wut der Wendegeneration, Luchterhand 2013, ISBN: 978-3630874050, 16,99 Euro (eBook 13,99 Euro)


