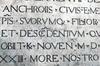Soll ich mich in einen engen Käfig sperren, mir das Fell über den Kopf ziehen, die Ohren kupieren, die Krallen rausreißen, die Knochen brechen, den Puschel stutzen lassen? Anders, zugegebenermaßen nur ein wenig seriöser gefragt: Soll ich mich freiwillig als Versuchskaninchen in die Fänge der Pharmaindustrie begeben, die an mir testen will, was ihre Medikamentencocktails so alles mit und aus Menschen und deren Ingredienzien machen können?
Ich sei geeignet, lobte man mich. Wow! Was qualifiziert mich? Dass ich noch lebe? Dass ich so manchen ärztlichen Rat in den Wind geschlagen, nicht alles geschluckt und gespritzt, genommen und getan habe, was mir anempfohlen wurde – und vielleicht gerade das das Geheimnis meiner (Über)Lebensfähigkeit ist? Dass ich noch relativ jung (jaja, relativ!) und für den stattlichen Umfang meiner Krankenakte ziemlich gut in Schuss bin, weil ich auf meine Fitness immer geachtet, mehr noch, dafür gekämpft und oft genug auch gelitten habe? Dass ich stur bin und einfach nicht akzteptieren will, dass das, was ich hinter mir habe, schon mein ganzes Leben gewesen sein soll?
Natürlich findet man umgehend ein meinen Zynismus zum Schweigen bringendes Argument: Ich könnte – und sollte vielleicht – einwilligen, damit ich anderen PatientInnen mit gleicher oder ähnlicher Krankheit helfen kann. Aber mit welchem eigenen Risiko tue ich das? Wie weit wird mein Altruismus gehen (müssen)? Was bringt es mir persönlich? Eine fifty-fifty-Chance, sagte mir ein Arzt. Auf was? Auf besser oder schlechter? Auf gleich gut / mittelprächtig / schlecht wie bisher – oder gar den Tod?
Vielleicht habe ich im Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten an der Uni zu gut aufgepasst, vielleicht aber bin ich einfach veranlagungsbedingt zu kritisch bis misstrauisch. Aber wer mich mit mehr Fragen als Antworten allein lässt, wird von mir kein „Ja, ich will!“ hören.