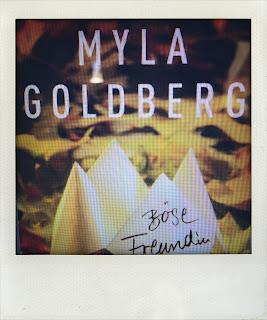
Die Axt holzte durch den Schwarzwald, schrieb Texte und entdeckte Waldgötter. Dazu liest sie gern dunkle Geschichten, die mit den tiefen Schatten und würzigen Düften des Waldes harmonieren. Myla Goldbergs Böse Freundin schien mir perfekt: Ich sah mich schon mit Rotwein und einem Schauer im Nacken bei Kerzenlicht schmökern.
Das wurde nichts. Ich bin stattdessen
Also: Erwachsene Frau kehrt in ihre Heimatstadt zurück, um nach zwanzig Jahren die bittere Wahrheit über das Verschwinden ihrer Schulfreundin zu beichten, die passenderweise ein äußerst bösartiges Kind gewesen ist. Das klingt doch ganz gut, oder? Jugendliche Soziopathen, verdrängte Erinnerungen, Spurensuche auf erkalteten Pfaden - Schlagworte, die ordentlich Spannung versprechen.
Aber nein. Böse Freundin ist mitnichten spannend erzählt, sondern gestaltet sich dermaßen langatmig, dass ich schon nach dem ersten Kapitel unter heftigem Angeödetsein litt. Das will etwas heißen, denn bekanntlich bin ich die Frau, die sogar dem haarsträubenden »Aurora-Effekt« einen gewissen Lesespaß abtrotzte. Tja, goldene Zeiten waren das. Böse Freundin nervt mit total unmotivierten Figuren, einer quälend zähen Handlung und einem extrem unbefriedigenden Ende, das schlicht Phantasielosigkeit nahelegt.
Protagonistin Celia schafft es, von der ersten bis zur letzten Seite keine einzige interessante Eigenschaft zu offenbaren. Ihre seltsamen Gedankensprünge deuten ständig irgendetwas an, um dann zu nichts zu führen. Die Dialoge sind einfach nur hölzern und unglaubwürdig. Ich kenne keine einigermaßen vernunftbegabten Menschen, die auf diese Weise miteinander kommunizieren. Celia, die von ihren Eltern und ihrem wahnsinnigen Freund auf schrecklich nervtötende Art immer »Cee-Cee« oder »Ceel« genannt wird, scheint kräftig einen an der Waffel zu haben. Ohne dass dies von der Autorin beabsichtigt wäre.
Die ganze Geschichte kommt daher wie ein Diorama: mit lebensecht angeordneten Elementen und hübschem Anstrich, aber blutleer wie ein ausgestopfter Fuchs. Apropos »wie ein« ... noch nie zuvor ist mir in einem Roman eine derartige Masse wahlloser Analogien aufgefallen. Dauernd reihen sich Häuser auf wie Perlenketten, hängen Handschuhe herum wie Fledermäuse, gleiten Limousinen wie Förderbänder. Diese und ähnliche Beobachtungen erwecken gelegentlich den Anschein, für die Geschichte relevant zu sein, aber sie sind es nie, was auf Dauer jeglichen detektivischen Elan im Leser erstickt. Die Erwähnung des klassischen alternden Polizisten, der von dem mysteriösen Fall des verschwundenen Mädchens geradezu besessen sei, lässt eine Weile hoffen – aber der Typ taucht nie auf, der existiert offenbar nur für die Dauer dieses Nebensatzes. Ich meine, WTF?!!!!
Irgendwann verrieten die wenigen verbleibenden Buchseiten, dass mit einer packenden Wendung nicht mehr zu rechnen sei. Entsprechend anspruchslos las ich dem Schluss entgegen, dessen einzige Überraschung darin bestand, noch unspannender zu sein als vermutet.
Schade ist’s freilich um die Geschichte, die vielen losen Fäden und toten Enden, die mit dem Zuklappen des Buchdeckels in der Bedeutungslosigkeit versinken. Ein letzter Wermutstropfen: die Übersetzung, die mich regelmäßig daran zweifeln ließ, ob die Autorin das jetzt allen Ernstes so geschrieben haben soll.
Wer sich für vierzehn neunundneunzig die seltene Erfahrung ultimativer Ratlosigkeit gönnen will, sollte dieses Buch unbedingt kaufen. Alle anderen investieren das Geld lieber in eine Flasche Schnaps, die macht mehr Spaß.

