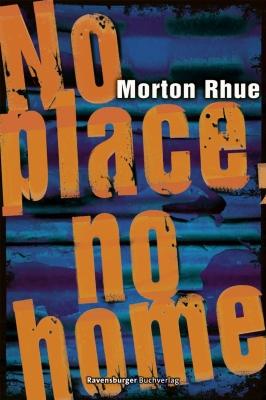 Sie leben in Wäldern zwischen den Bäumen, in Parks hinter Sträuchern. Sie sitzen auf Parkbänken und Mauern und essen hinter Mülltonnen. Die Unsichtbaren unter uns, die keinen Platz mehr in der Gesellschaft finden. In Deutschland leben zur Zeit rund 248.000 Menschen (Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe laut 4. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2012) ohne festen Wohnsitz, davon rund 22.000 dauerhaft auf der Straße. Sie konnten nicht mehr bei Verwandten oder in Heimen unterkommen und sind nun obdachlos. Die Ursachen dafür sind so verschieden wie die Menschen. Manche haben ihren Job verloren und konnten ihre Miete nicht mehr zahlen. Manche haben ihr Haus durch eine Überschwemmung oder eine andere Naturkatastrophe verloren. Einige wurde von ihren Partnern rausgeworfen oder sind vor häuslicher Gewalt geflohen, geflohen auch aus den staatlichen Einrichtungen wie Obdachlosen- oder oft auch schon Kinderheimen. Rund 21 % der Wohnungslosen sind unter 25 Jahre alt. In Amerika ist die Obdachlosigkeit ein traditionsreiches Thema. Man denke an die Zeit der Großen Depression. Fehlende soziale Absicherungen lassen den Verlust des Wohnraumes in den Zeiten der aktuellen globalen Finanzkrise zu einer stetigen Bedrohung werden. Laut Angaben der National Coalition for the Homeless leben in den USA über das Jahr rund 3,5 Mio. Menschen dauerhaft oder zeitweise auf der Straße. Davon haben rund 20 % sogar ein Job, der Lohn reicht aber nicht für eine Wohnung.
Sie leben in Wäldern zwischen den Bäumen, in Parks hinter Sträuchern. Sie sitzen auf Parkbänken und Mauern und essen hinter Mülltonnen. Die Unsichtbaren unter uns, die keinen Platz mehr in der Gesellschaft finden. In Deutschland leben zur Zeit rund 248.000 Menschen (Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe laut 4. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2012) ohne festen Wohnsitz, davon rund 22.000 dauerhaft auf der Straße. Sie konnten nicht mehr bei Verwandten oder in Heimen unterkommen und sind nun obdachlos. Die Ursachen dafür sind so verschieden wie die Menschen. Manche haben ihren Job verloren und konnten ihre Miete nicht mehr zahlen. Manche haben ihr Haus durch eine Überschwemmung oder eine andere Naturkatastrophe verloren. Einige wurde von ihren Partnern rausgeworfen oder sind vor häuslicher Gewalt geflohen, geflohen auch aus den staatlichen Einrichtungen wie Obdachlosen- oder oft auch schon Kinderheimen. Rund 21 % der Wohnungslosen sind unter 25 Jahre alt. In Amerika ist die Obdachlosigkeit ein traditionsreiches Thema. Man denke an die Zeit der Großen Depression. Fehlende soziale Absicherungen lassen den Verlust des Wohnraumes in den Zeiten der aktuellen globalen Finanzkrise zu einer stetigen Bedrohung werden. Laut Angaben der National Coalition for the Homeless leben in den USA über das Jahr rund 3,5 Mio. Menschen dauerhaft oder zeitweise auf der Straße. Davon haben rund 20 % sogar ein Job, der Lohn reicht aber nicht für eine Wohnung.In der amerikanischen Kleinstadt Average (deutsch: Durchschnitt), von der uns Morton Rhue in seinem neuen Roman erzählt, werden die Unsichtbaren plötzlich sichtbar. Die Stadt stellt ihnen einen Park zur Verfügung, auf dem Dignityville entsteht – ein Zeltlager für die Wohnungslosen – oder wie es auch heißt: „ein Auffangbecken für menschliches Treibgut“. Plötzlich sind sie da, wo sie jeder sehen kann – im Zentrum der Stadt, ganz in der Nähe des Rathauses. Plötzlich werden sie Teil der öffentlichen Diskussion. Es lässt nicht lange auf sich warten, bevor die engagierten Befürworter und die kritischen Gegner hart aufeinanderprallen.
Im Prolog des Buches erfahren wir über Aubrey, einen Bewohner der Zeltstadt, der gleichzeitig die Stimme der BewohnerInnen nach außen ist, dass er von mehreren Schlägern brutal verprügelt wurde und schwerverletzt im Koma liegt. Ein harter Opener, der den LeserInnen direkt vor Augen führt, mit welcher Härte das Schicksal in diesem Roman zuschlägt.
Im ersten Teil lesen wir, warum die Zeltstadt im Herzen von Average entstand. Nicht etwa, weil die Stadt ihren Leute (nur) helfen wollte. Es ging vor allem darum, sie alle auf einem Haufen zu haben, um Geld zu sparen, denn: „Nur weil Bürger einer Stadt sich keinen Wohnraum leisten können, bedeutet das nämlich nicht, dass ihnen nicht dieselben kommunalen Dienstleistungen zustehen wie allen anderen.“ So gibt es von der Stadt finanzierte Waschcontainer und Dixie-Toiletten, eine medizinische Grundversorgung und täglich zwei kostenlose Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr. Ehrenamtliche Helfer stellen eine warme Abendmahlzeit zusammen und es gibt einen Anschluss an das Stromnetz.
Für die Bewohner wird Dignityville schnell zu einem Ort, der Hoffnung birgt. Ein Ort, an dem man zur Ruhe kommen kann, an dem man Gemeinschaft und Hilfe findet, an dem Pläne für ein kleine autarke Ökosiedlung geschmiedet werden. Sehr zum Missfallen zahlreicher Bewohner der Stadt, die in Immobilien investiert haben, deren Wert durch die Nachbarschaft zur „Auffangstation“ ihren Wert verlieren. Menschen, die so einiges tun, um ihr Vermögen nicht zu gefährden und im Laufe des Romans jede Möglichkeit ausschöpfen, um ihr Gut zu schützen und Dignityville zu zerstören.
Erzählt wird die Geschichte mit der Stimme des 17-jährigen Highshool-Starpitchers Daniel. Seine Mutter hat BWL studiert und als Portfoliomanagerin bei einer Vermögensverwaltung gearbeitet, bevor diese pleite ging.
Sein Vater hat einen Abschluss in Sportwissenschaft und trainierte im Rahmen eines staatlich finanzierten Sozialprojektes Jugendliche aus Problembezirken bis auch dieses Projekt aus Kostengründen eingestellt wurde. Eine fast klassische amerikanische Mittelstandsfamilie mit eigenem Haus auf Kredit und ausreichender Fallhöhe.
Wir haben es hier mit einem jugendlichen Ich-Erzähler zu tun, dessen Sicht auf die Umstände wir folgen. Noch vor ein paar Wochen war er mit seinen Kumpels am Parkgelände vorbeigefahren und gestern noch hat er als freiwilliger Helfer in der Kirchenküche Chili gekockt, bevor er heute selbst im alten Subaro seiner Eltern vorfährt und sein selbstgekochtes Essen zum Abendbrot serviert bekommt. Für ihn ist Dignityville kein Ort voller Hoffnung, sondern erstmal eine „Endstation für arme, unglückliche Menschen, die andernfalls in Hauseingängen oder Autos schlafen müssten.“
Im zweiten Teil werden wir zurück in die Gegenwart geholt.
Nachdem der erste Teil rückblickend den Weg der Familie nach Dignityville zeigte, beschäftigt sich der zweite mit dem Leben in Dignityville. Während Dan langsam einsehen muss, dass er jetzt arm ist und leugnen nichts bringt, haben seine Freunde, allen voran seine Freundin Talia, die aus eher gehobeneren Verhältnissen stammt, noch echte Schwierigkeiten, mit Dans neuer Situation umzugehen. Talia versucht ihn zu unterstützen, möchte ein Stipendium ins Leben rufen und zahlt die Rechnungen bei gemeinsamen Unternehmungen, verursacht dabei leider nur noch größere Probleme, sodass das sich Ende dieser Beziehung schnell abzeichnet. In aller Not und Verzweiflung versuchen alle nur ihre Würde (engl. dignity) zu bewahren, bevor sie wieder von der Bildfläche verschwinden.
Mit dem Wechsel vom Präteritum ins Präsens wird im zweiten Teil eine größere Unmittelbarkeit und Dramatik erzeugt. Nach der vorherigen Rückblende wird nun etwas erzählt, das der Erzähler selbst noch nicht kennt. Wohin wird es gehen? Er kann nicht mehr auf einen Zielpunkt (Einzug ins Zeltlager) hin erzählen, sondern nur noch von seiner jetzigen Situation aus in die Zukunft blicken. Ein Kunstgriff, mit dem Morton Rhue wunderbar auch den Wechsel in der Wahrnehmung des Protagonisten nachzeichnet.
Auch sprachlich kann das Buch überzeugen. Der Autor hat einen schlauen jungen Mann gewählt, mit dessen jugendlicher Stimme sich diese schwere Thematik gut erzählen lässt. Er schreibt unaufgeregt aber deutlich. Einfach und in keiner Weise unglaubwürdig.
Morton Rhue hat mit seinem Buch nicht nur die aktuelle Finanzkrise in ihren Auswirkungen ins Blickfeld gerückt, sondern es geschafft, eine Brücke zur Großen Depression in den 1930ern zu schlagen und damit auch die geschichtliche Dimension der Ereignisse zu berücksichtigen. Er lässt Dan immer wieder Zeilen aus dem Buch Früchte des Zorns von John Steinbeck zitieren, das zu seiner Schullektüre gehörte. Auch anhand dieser Romanlektüre gelingt es Dan, sein eigenes Schicksal als gesellschaftliches Problem zu reflektieren. „Wie kann es sein, dass trotzdem so viele Probleme, mit denen die Menschen schon damals zu kämpfen hatten, heute immer noch nicht gelöst sind?“, ist die letzte Frage, die Dan im Roman stellt. Wem?
Auch wenn no place, no home zumeist als Jugendbuch beworben und besprochen wird, ist es vor allem ein Sozialdrama, das mit einer jugendlichen Stimme erzählt wird, die kein Mitleid erregen möchte, die keine belehrenden Floskeln oder politische Anklagen vorbringt, sich aber mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Themen auseinandersetzt und so auf sehr eindringliche Weise auf ein globales Problem aufmerksam macht. Eine Stimme, die alle etwas angeht.
- Tags: 2013, Literatur, Morton Rhue, Obdachlosigkeit
About the Author
Autor Kristin Gora
Bitte Kommentar schreiben
Sie kommentieren als Gast.


