Kurz
Bedrohlich
Obskur
Michael Fehrs reduktionistische Prosa verdichtet sich im Kriminalfall „Simeliberg“ zu einem düsteren Schwarz-Weiss-Gemälde menschlicher Abgründe.
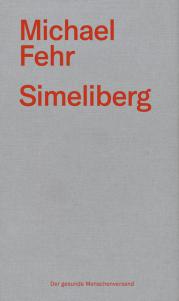
Drunten im Tal, abseits des sowieso schon abgelegenen Dorfes, hat sich der alte Bauer Schwarz ein überdimensionales Haus gebaut. Da lebt er, scheinbar bettelarm, mit seiner Frau. Als die Frau eines Tages nicht mehr im Dorf auftaucht, setzen sich erste Gerüchtewellen in Bewegung.
Der Gemeindeverwalter Griese, Sohn eines deutschen Vaters und als solcher ohne Chance, jemals vollwertiger Teil der Dorfgemeinschaft zu werden, wird hinab geschickt, um Schwarz zu holen und in die Stadt zu bringen, wo die Sozialhilfe seine Ansprüche auf Fürsorge prüfen soll.
Schwarz scheint irr: er schwadroniert vom Sozialismus, hat Pläne, den Mars zu kolonisieren und eine Kassette mit Bündeln von Tausendernoten. Von wegen bettelarm. Griese schöpft Verdacht und bleibt dran, obwohl ihn niemand für zuständig hält.
Als kurz darauf – Schwarz ist in der Stadt in Gewahrsam – das grosse Haus explodiert und sieben junge Männer, die Schwarz als Guru verehrt und ihn finanziert haben, dabei ums Leben kommen, wendet sich die Stimmung gegen Griese, den halbfremden Gemeindeverwalter. Wurde der nämlich nicht bei Schwarz‘ Haus gesehen? Hat der nicht von einer Kassette mit Tausendernoten geredet, die niemand mehr findet? Hat der nicht immer ein Gewehr im Auto?
Der junge Schweizer Autor Michael Fehr leidet an einer Sehschwäche, die es ihm nicht erlaubt zu lesen und zu schreiben. Stattdessen hört und spricht er. Seine Texte auf ein Diktiergerät etwa. Er braucht weder ganze Sätze noch Satzzeichen. Seine Sprache besteht aus aufeinandergetürmten Fragmenten, die rein optisch den Eindruck erwecken, man habe es mit einem Versepos oder ähnlichem zu tun.
Doch der erste Blick täuscht, wie so oft. Es ist eben gesprochene und gehörte Sprache, rauh und dialektgefärbt, die hier in derben Stakkatosalven verschossen wird. Sprache, die ihren markantesten Ausdruck in der Textform des Telefongesprächs findet, die immer wieder zum Einsatz kommt: Griese telefoniert – die Stimmen am anderen Ende der Leitung bleiben stumm, müssen von den Lesern selbst ergänzt werden.
So funktioniert „Simeliberg“: ein Bruchteil dessen, was ist, steht auch da, sich den Rest hinzuzudichten obliegt den Lesern. Man kann dem Buch vorwerfen, es blieben letztlich zu viele Fragen offen. Man kann aber auch sagen: es ist viel Raum zum Selberdenken vorhanden.
Und die Gedanken schweifen ab in die düstere Gefilde. Grieses Ausweglosigkeit inmitten des ganzen Schwarz-Weiss-Panoramas – alle Figuren ausser ihm heissen Schwarz oder Weiss/Wyss – wird sehr schnell klar. Gefangen in einem Netz aus undurchschaubaren bürokratischen Verfahren und latentem Fremdenhass ist es ihm zunehmend unmöglicher, seine Meinung geltend zu machen.
Polizei, Sozialhilfe und Dorfgemeinschaft scheinen sich zu verbrüdern und Position für den Scharlatan Schwarz zu beziehen: seine wirren Mars-Pläne werden als legitimer Trost nach dem Tod der Frau interpretiert.
Ein fundamentales Paradox wird offenbar: das exotische und ferne Andere fasziniert, das Andere, das bereits hier ist, eben das „Fremde“, provoziert und erregt Hass. Es ist eine der Schlussfolgerungen, die ich „Simeliberg“ entnommen habe – ein Gedanke, den man sich auch in den politischen und gesellschaftlichen Diskussionen dieser Tage wieder einmal bewusst machen sollte. Ein heuchlerisches Herrengefühl, das nicht nur in den hintersten Schweizerkrachen, sondern in grösseren Teilen Westeuropas seine unsäglichen Bahnen zieht.
“Simeliberg”, diese “existenzielle Geschichte zum Thema Schuld”, wie der Autor sie im Interview mit Der Zeit selber nannte, legt in groben Wortskizzen viele Verbohrtheiten und Vorurteile unsere Gesellschaft offen, über die es sich auch in weitgefassterem (europäischem, globalem) Kontext nachzudenken lohnt.
Fehr, Michael. Simeliberg. Luzern: Der gesunde Menschenversand, 2015. 142 S. ISBN 978-3-03853-003-9

