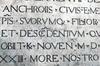Was machen eigentlich private Hochschulen besser? Warum geht es bei vielen staatlichen Unis noch heute – oder mehr denn je? – zu wie am Hindukusch? In München zieht, tropft und modert es wie vor 20 Jahren, als ich dort wegen überfüllter Hörsäle auf dem Boden statt auf den klapprigen Holzsitzen Platz nahm. Heizung? Bücher? Digitale Medien? Computerarbeitsplätze? Gesundes Essen? Ansprechbare Professoren? Stattfindende Veranstaltungen? Dozenten, die ihre Sprechstunden, Vorlesungen und Seminare selbst halten anstatt Doktoranden zu versklaven – die eigentlich andere Aufgaben hätten, wollen sie in weniger als fünf Jahren promovieren? München ist Bayern – und Bayern ist wahrlich kein armes Bundesland! Woran also krankt es?
Darüber wurde schon viel diskutiert. Am Geld liegt es wohl nicht, heißt es. Eher an der Verwaltung, am Management. Private Unis – interessanterweise Businesshochschulen! – haben sich zwar auch schon durch die Unfähigkeit hervorgetan, ein Unternehmen zu leiten. Eine private Bildungseinrichtung ist nun einmal ein ganz normales Unternehmen, auch wenn das gern bestritten wird. Da braucht es Einkünfte, mit denen man überlegt umgeht, um die anfallenden Kosten und Investitionen zu finanzieren, um den Betrieb aufrecht zu halten und Qualität auch in Zukunft zu gewährleisten. Das klappte nicht immer, denn Image maß man oft genug in Statussymbolen. Und die verschlangen mitunter mehr Zaster, als Studenten und Förderer locker machen wollten.
Was also machen private Hochschulen – die guten unter ihnen! – denn nun besser? Ich denke, sie kümmern sich um schlicht um ihre Klientel, also um ihre Studenten. Sie bilden in Richtung (globalem) Arbeitsmarkt aus, sie wissen, dass für Absolventen Geld und Karrieren nicht vom Himmel fallen, dass hohe Kompetenz wichtiger als ein schickes Siegel unter der Abschlussurkunde ist. Dozenten dieser Unis brauchen keinen realitätsentrückten Forscherhabitus, sie definieren Erfolg etwas anders als in Publikationen und Zitierungen. Zugegeben, das war nicht immer so, hier fand ein Sinneswandel statt – musste stattfinden, denn Studenten sind erst einmal Kunden. Ein paar deutliche Worte dazu fand in der FAZ einer, der sich in Zürich eine Hochschule gekauft hat und nun beweisen will, dass er aus ihr einen respektierten Quality Player machen kann. Es sieht ganz gut aus…
Ein Absatz des Interviews in der FAZ:
Bei uns haben die Professoren zum Beispiel keine Büros. Auch ich sitze mitten unter den Studenten. Unsere Dozenten sind nicht fest bei uns angestellt, es ist eher ein Netzwerk von Professoren. Außerdem wollen wir wenig an die Tafel schreiben; uns geht es darum, miteinander zu sprechen. Das kommt bei den Studenten gut an. Auf altmodische Gepflogenheiten verzichten sie gerne, stattdessen wollen sie Schnelligkeit, Zugänglichkeit auch am Wochenende. Mein Eindruck ist, dass viele Business Schools früher vor allem ein bequemer Ort für die Professoren waren.