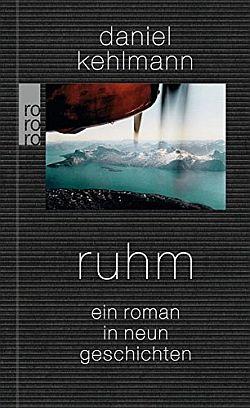
STERBEN IN DER METALEPSE
Daniel Kehlmann vermischt in "Ruhm" Geschichten über das Schreiben als brutalen Akt Daniel Kehlmann habe gelitten während des Schreibens an "Ruhm", einem Episodenroman in neun Geschichten.Dieses außer- und innerhalb der erzählten Welt grassierende Leid sucht vor allem Rosalie heim, eine von Kehlmanns verschrobenen Kunstfiguren. Rosalie, die sterben geht, weil sie sterben soll, aber nicht so recht sterben will. Sie bittet, bettelt, bebt und spricht zu ihrem Schöpfer, dem Schriftsteller Leo Richter, dem Schriftsteller Daniel Kehlmann wiederum, um am Leben zu bleiben. Rosalie ist krebskrank und gleichzeitig krank vor ohnmächtiger Hoffnung, Teil einer Geschichte zu bleiben, die der Schriftsteller wie Gott nach seinen Wünschen umgestalten kann."Ruhm" erweist sich als vertrackte Selbstoffenbarung nach Kehlmanns flirrender Abenteuer-Melange "Die Vermessung der Welt" ein paar Jahre zuvor, als zärtliches, als brutales Romanfragment der Auslöschung, aber auch der Neudichtung, des Zufalls, aber auch des Zerfalls, der Selbstreflexion wie des Schaffens von Lügen in Wahrheiten und Wahrheiten in Lügen. Kehlmann gelingt es, ein literarisches Bewusstsein zu verknoten und daraus vergnügliche Zwischenberichte zu konstruieren. Was ihm nicht gelingen mag, zehrt an seiner Literatur seit Anbeginn: In beständiger Beharrlichkeit, es dem Leser wie dem Kritiker leicht zu machen, um, voll des Lobes, anhaltenden Erfolg abzuschöpfen, hält es Kehlmann für falsch, diesem postmodernen Geflecht manierierten Zusammendichtens die Ironie zu verweigern – anstatt ihm Menschlichkeit einzuflößen.In „Ruhm“ sind folglich alle Akteure an einer Schicksalskette miteinander verbunden, sei es durch motivische Zusammenhänge oder thematische Hauptgedanken. Die Aufspaltung der Identität, die Entfremdung des Subjekts, die Vergänglichkeit des Ruhms, das Versagen der Technik, das Wegbrechen der Realität, die Transzendenz des Todes, all‘ dies umweht Kehlmanns Protagonisten, ihres Zeichens Suchende in einer unvorhergesehenen Orchestrierung von leicht surrealen Wahrnehmungskonflikten.
Ob "Ruhm" allerdings mehr die spielerische Postmoderne oder die klassische Erzählakrobatik bevorzugt, ist ein Widerspruch in sich, denn sowohl Welterzählung als auch Kommentierung derselben konkurrieren untereinander. Daniel Kehlmann, das wird offensichtlich, will es jedem recht machen, dem zwanglosen Zwischen-den-Zeilen-Leser genauso wie dem peniblen Logikverfechter. Dies macht "Ruhm" bisweilen uninspiriert und dramaturgisch unausgeglichen.Für einen postmodernen Roman nämlich verhält sich "Ruhm" kontradiktatorisch zu den Prämissen postmodernen Erzählens. Mit Sicherheit: Ausgelassene Erzählwechsel, doppelbödige Hypercodierungen und bandwurmartige Verknüpfungen rhythmisieren eine Konstruktion an einzelnen, qualitativ schwankenden Verästelungen, die als metafiktives Konstrukt über alle Wahrscheinlichkeiten hinausweist. Wo die Postmoderne den Sinngehalt im Ungefähren sucht, breitet ihn "Ruhm" jedoch im dezidiert Eindeutigen aus. Permanent klingelnde Telefone, reflektierende Spiegel und fremde Kulturen stoßen den Leser mit der Nase auf die diskussionsanstoßende Botschaft eines Autors, der nimmermüde wird, die plakativ-pathetische Geste zu bemühen. Wie es scheint, zeigt Kehlmann großes Interesse an der bloßen Mechanik von geistig verschmolzenen Gefühlswelten. Sein Interesse für die Träger dieser Gefühle tendiert gleichwohl gegen Null.
Die Marionettenfäden hinter Kehlmanns Charakteren sind deshalb stets präsent. Dies ist ein Problem, vielmehr aber noch ein Missverständnis. Ob ein sich an seiner unverhofft neuen Identität berauschender IT-Techniker, ein das Alltagsleben genießender Schauspieler oder eine resignierende Autorin von Kriminalromanen – sie werden auf stereotype, ungemein einfältige Stichwortgeber begrenzt, werden nach Belieben verrückt, durch ihre Geschichte somnambul geschoben, ohne an dieser teilzunehmen oder sie etwa eigenhändig zu gestalten. "Ruhm" fußt auf einem unsicheren Fundament, gleichermaßen stringent erzählen wie abstrakt montieren zu wollen. Für eine einzige Strategie hiervon konnte sich Daniel Kehlmann nicht entscheiden, und genau dies führt zu einer Verzerrung der Intention.Unlängst beliefert Kehlmann ganze Schulklassen mit seinen Werken. Er ist aus jenen Klassenräumen, die sich dafür eignen, analytisch Literatur aufzubereiten, gar nicht mehr wegzudenken.Das Kehlmann-Œuvre, wird es einer genaueren Betrachtung unterzogen, ist dafür aber prädestiniert. Ein vermindertes künstlerisches Risiko und die erhöhte Zuversicht dahingehend, ein biederes Textgewebe zu schaffen, bescheinigt Kehlmann ein handwerkliches Können zwar, aber kein Schwelgen in Gedanken, Blitzeinfällen, sprachlichen Absurditäten, einem Stück Wahnsinn, einer Prise Chaos. Würde Kehlmanns Prosa einen Teil der Schule versinnbildlichen, es wären die grauen Wände. Unauffällig, brav, duckmäuserisch, allenfalls sporadisch aufmerksamkeitserheischend.
Immerhin – mit Daniel Kehlmann darf dezent gelacht werden. Auch in "Ruhm". Es ist ein tragikomisches Gedankenspiel, das seine eigene Künstlichkeit heraushebt und psychologisch abenteuerliche Minisituationen ausspielt. Wenn Kehlmann eine Taxifahrt schildert, die an grotesk übersteigerten Sprachbarrieren ununterbrochenen scheitert, wohingegen ein schwächer werdender Telefonakku kaum lakonischer den schwindenden Ruhm eines vergänglichen Lebens symbolisiert, trifft Kehlmann pointiert eine Gegenwart, die sich mit beinah außerweltlicher und dionysischer Verzweiflung gegen die verführerische Freiheit der Parallelfiktion selbst betäubt.Allerdings birgt die parodistisch durchbrochene Atmosphäre manch‘ kurzer Episode die Gefahr eines repetitiven Gags, dessen Pointe daher bemüht wirkt. Mollwitz ist eine dieser zotigen Pointen, ein internetsüchtiger Mitarbeiter einer Mobilfunkgesellschaft, neurotisch, cholerisch, infantil, das Abziehbild einer (vermeintlichen) Facebook-Generation, die von Post zu Post lebt. Kehlmann stattet Mollwitz mit einem Stil aus, der zwischen Katastrophen-Orthografie und Kauderwelsch-Eloquenz changiert. Stellt sich etwa in dieser Form ein intellektueller Schriftsteller ein Milieu vor, von dem er augenscheinlich gelesen, es jedoch nie durchlebt hat? "Ruhm" übertritt gerade in solcherlei Momenten kindlicher Fantasterei die Grenze der Karikatur, um mit dem absehbaren Mittel eines bildungsbürgerlichen Zynismus etwas zu belächeln, was, im Gegenteil, sensibler Empathie bedurft hätte.
Wo aber ist "Ruhm" letztlich überhaupt anzusiedeln? In der Tradition Paul Austers und am "Nullpunkt der Literatur", wie ihn der französische Semiotiker Roland Barthes postulierte, vermischt Kehlmann sprunghaft nach Einzelaugenblicken verformte Realität und deren Imagination in einem semiotischen System rätselhafter Fragmente – und wie das eine das andere zersetzt. Eine Schwäche des Romans ist es im Hinblick dessen, dass Barthes' Theorem möglicherweise nicht vollkommen die nötige Ausführung fand. Denn Daniel Kehlmann "verschwindet" nicht, als Autor, als Gott, als höhere Instanz. Er wird stattdessen deutlich von seinen abgegriffenen Wiederholzwängen beflügelt, wodurch „Ruhm“ an manchen Stellen umso überkandidelter, ja selbstverliebter die Erzählung dekonstruiert – und Daniel Kehlmann somit die Selbstbestätigung erhält, dass sich das Leiden trotzdem gelohnt hat. Lang lebe die Geschichte. Oder der Ruhm.
Diese Rezension war eine benotete Auftragsarbeit.


