Das war vom 15. bis 18. August 1969.
Ich wäre gerne dort gewesen. War das Leben so? Wo war mein Leben geblieben?
Hatte ich schon zu viele Landmanieren angenommen? Ich brauchte eine kleine Auszeit!
Eine Arbeit zu suchen, war ich im Moment nicht in der Lage.
Mit meinem Auto fuhr ich durch die Gegend, bis ich Kurt im „White-Horse-Club“ in Offenbach traf und dieser mich mit seinen palästinensischen Freunden bekannt machte.
Damit begann für mich eine neue Ära. Die Jungen hingen den ganzen Tag in den verschiedenen Kneipen, die sie Cafés nannten, herum. Sie diskutierten den lieben langen Tag und sprachen darüber, wie ungerecht sie von den Israelis und dem Rest der Welt behandelt würden.
Ich sagte ihnen, dass das, was sie da manchmal machten, sehr feige sei und ihnen keine Sympathie in der Welt einbringen würde. Sie müsste der Welt zeigen, dass sie unterdrückt würden, war ihr Argument. Und das ginge nur mit Aufsehen erregenden Geschehnissen, auch ohne, dass ein Palästinenser ums Leben käme.
Ich wusste nicht, was sie auskochten, aber es war mir auch egal. Ich hatte meine eigenen Sorgen.
Kurt kam auf eine Idee und erzählte mir, dass viele von ihnen Autos in den Libanon überführten und dabei gut verdienten. Er selbst hatte schon einige Fahrten mitgemacht und er wollte wissen, ob ich Lust hätte, mit ihm in das Geschäft einzusteigen.
Nach einigen weiteren Gesprächen war es abgemacht, dass wir mit gebrauchten Autos in den Libanon fahren würden. Das musste ich jetzt nur noch meiner Frau beibringen.
Sie hatte doch ihre Mutter, die noch lebende Tote, bei sich und war nicht allein. Die beiden Frauen würden sicher in der Lage sein, unsere kleine Tochter zu erziehen und gut auf sie aufzupassen.
Nach einigen kleineren Diskussionen war Chitra bereit, mir die Chance zu geben und das Auto-Geschäft zu machen. Ich bezahlte die Miete für einen Monat im Voraus. Dabei gab ich das Geld dem Vermieter direkt, nicht meiner Frau. Sie erhielt einen Betrag, der reichte, um Essen zu kaufen und sonst nichts.
Mein Auto verkaufte ich, legte noch etwas Geld dazu und schon hatte ich Startkapital.
Für fünfhundert Mark kaufte ich mit Expertenhilfe von Kurt einen Mercedes 180 Benziner, das gleiche Modell verschaffte sich auch Kurt.
Die Reise nach Beirut klappte wunderbar und ich wurde mein Auto für zweitausend Libanesische Pfund schnell los, was etwa zweitausend Mark gleichkam.
Per Sammeltaxi fuhren wir von Beirut nach Damaskus, von dort ging es mit der Interflug, der DDR-Fluggesellschaft, nach Ostberlin, mit dem Transit-Bus nach Westberlin und dann mit Lufthansa nach Frankfurt. Kontrollen gab es überhaupt nicht.
Die Araber hatten keine Lust zu kontrollieren und die Ostberliner brauchten nicht zu kontrollieren, da wir im Osten nicht aussteigen durften. In Westberlin wurde ebenfalls nicht kontrolliert, weil wir ja aus Ostberlin kamen und was konnte man von dort schon mitbringen? Berlin - Frankfurt war innerdeutsch, also auch keine Kontrolle. Zu jener Zeit waren die palästinensischen Bombenleger noch nicht unterwegs. Das kam erst später.
Das Libanesische Pfund hatte zur Mark den gleichen Wert. Bei meinem Kassensturz stellte ich fest, dass das Geschäft mit den Autos angenehm war.
Nach dem Einkauf und Abzug der Reisekosten hatte ich noch eintausend Mark übrig - das war doch toll! Die ganze Rundreise dauerte vierzehn Tage, das hieß, man konnte zwei Mal pro Monat reisen und würde damit zweitausend Mark verdienen.
Mehr, als mit der Kneipe und mehr, als bei jeder normalen Arbeit.
Natürlich vergaß ich mögliche Risiken, einen Unfall zum Beispiel oder ein Auto, was es nicht ans Ziel schaffen könnte. Auch war ich nicht versichert und zahlte auch nicht in die Rentenkasse ein. Aber wenn man jung ist, kommen diese Überlegungen ganz zum Schluss.
Für den Moment sah ich nur den großen Gewinn, und wenn das ein paar Reisen lang gut ging, konnte ich meine Schulden begleichen und wäre ein freier Mann.
Meine Schulden drückten sehr auf mein Gemüt.
Wie schön musste es doch ohne Schulden sein, dann konnte man wieder machen, was man wollte und musste nicht ständig davonlaufen. Meiner Frau und ihrer Mutter ging es gut, doch nur solange, wie genug Geld im Haus war. Mir war klar geworden, dass im Falle einer Geldknappheit beide nach Ceylon verschwinden würden. Doch ich machte ein paar Reisen und hatte Glück. Alles verlief gut und ich konnte auch meine Gläubiger bezahlen.

Chitra wollte unbedingt eine Fahrt mitmachen und ich erlaubte es.
Sie hatte keinen Führerschein, so mussten wir zu zweit in einem Auto fahren. Diese Reise würde etwas unbequemer werden, der Platz für zwei Personen zum Schlafen im Auto war schon sehr knapp. Und ein Hotel trieb die Kosten in die Höhe. Doch Chitra bettelte so sehr, dass ich keine Chance hatte und sie fuhr mit. Also musste ein Kompromiss her.
Ich kaufte ein größeres Auto, einen 220er Mercedes, der natürlich teurer war, aber beim Verkauf mehr einbringen würde, war doch logisch.
Dann kamen zwei Flugtickets dazu und die doppelte Verpflegung.
Meinen Eltern versprach ich, dass ich sie nach der nächsten Reise besuchen würde. Sie glaubten mir schon gar nichts mehr, und Vater erinnerte mich immer wieder daran, dass ich doch einer geregelten Arbeit nachgehen sollte, schon wegen der Rente.
Scherzhaft antwortete ich ihm, dass Renteneinzahlung verschenktes Geld sei, denn so alt würde ich nicht werden.
Mein gebunkertes Geld hatte ich in einem sicheren Versteck, das Frau und Schwiegermutter nicht kannten.
Im Keller hatte ich eine Kartoffelkiste für gut einen Sack Kartoffeln. Diese Kiste hatte einen doppelten Boden, damit die Luft zirkulieren konnte. Dort hatte ich eine Blechkiste mit meinem Geld. Und ein Sack Kartoffeln lagerte darüber. Wie war das noch einmal? Vertrauen ist gut, doch Verstecken ist besser.
Chitras Mutter, meiner Schwiegermutter, wurde noch einmal ans Herz gelegt, das sie sehr gut auf unsere kleine Tochter aufpassen sollte. Geld hatten wir der Nachbarin gegeben und sie gebeten, ein Auge auf Schwiegermutter und die Kleine zu werfen.
Unsere Reise führte uns durch Salzburg, Graz, Maribor, über die fürchterliche jugoslawische Autopiste, die bis zu einem halben Meter tiefe Schlaglöcher hatte, bis nach Belgrad. Ab Belgrad wurde die Straße besser.
Der Ostblock hatte mich schon immer genervt, da die Menschen dort nicht lebendig wirkten, sie schienen schon tot zu sein, aber hatten es nur noch nicht gemerkt.
Es kam keine Freundlichkeit von ihnen, nur barsche Töne, und immer hatte ich das Gefühl, dass sie in einer ständigen Angst lebten. Vor wem sie Angst hatten, das wusste ich nicht, aber sie machten mir auch Angst.
In allen Ländern hinter dem „Eisernen Vorhang“, ob in Polen, Russland oder einem anderen Ostblock-Land, waren die Menschen immer irgendwie verängstigt. So, als ob man sie täglich verprügeln würde.
Ich fuhr also nur ungern durch Bulgarien, doch es gab keine andere Möglichkeit. Italien und Griechenland waren zu weit und zu teuer. Sofia, Bulgariens Hauptstadt, war sehr schön. Wenn die Bulgaren nicht dort gewesen wären, hätte man sich in diese Stadt verlieben können.
Ich hatte mich schon auf einer meiner vorherigen Reisen verliebt. Nicht in die Stadt, auch hieß sie nicht Sofia, sondern Sofie.
Sie war superhübsch und superschlank, außerdem intelligent und die Botschafterin eines europäischen Staates. Ich schätzte sie als Mittdreißigerin, doch als ich ihr wahres Alter von zweiundfünfzig Jahren hörte, nahm ich Reißaus.
Zu dieser Zeit, mit meinen achtundzwanzig Jahren, war eine Frau über fünfzig schon so viel wie verwest.
Erst später stellte ich fest, wie voreingenommen und blöde ich damals war.
Heute weiß ich, dass eine Frau mit fünfzig grade erst das richtige Alter hat! Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich war also dieses Mal mit Chitra unterwegs und sie hatte auch - wie ich - das diffuse Angstgefühl, wenn die Polizisten in ihren dunklen Uniformen auf freier Straße, ganz plötzlich hinter einem Baum hervorkamen und schrieen, dass man zu schnell gefahren wäre.
Man hatte keine Chance, darauf aufmerksam zu machen, dass sie das gar nicht feststellen könnten, da sie ja kein Radarmessgerät hätten.
Man hörte nur: „Wir Polizei, du zu schnell, du zahlen zwanzig Dollar, Dollar Amerika!“
Wenn man dann erklärte, dass man nur die bulgarischen Lewa hätte, wurde man darauf verwiesen, dass es auch Deutsche Mark sein können aber dann seien fünfzig fällig.
Die wollten keine Lewa, nur Valuta.
Um weiterfahren zu können, kam man nicht drum herum und musste die verlangten Scheine hinblättern. Bestand man darauf, eine Quittung zu bekommen, wurde alles noch komplizierter und der Preis verdoppelte sich. Also keine Quittung und nichts wie weg! Das konnte einem bis zu drei- oder vier Mal am Tag passieren.
Schuld waren die Nummernschilder, das waren deutsche, ovale, weiße Schilder mit schwarzen Zahlen und einem großen „Z“ in der Mitte. Es waren unsere Zollnummernschilder.
Sie waren als „Jumurta Placka“ bekannt.
Das war wohl Türkisch und sollte so viel wie „Eierschild“ heißen. Nicht genug, dass man an der Grenze offiziell bulgarische Lewa zwangsweise tauschen und Benzin-Coupons mit Westwährung kaufen musste.
Wenn man es durch Bulgarien geschafft hatte und an der anderen Grenze seine eingetauschten Lewa zurücktauschen wollte, war entweder kein ausländisches Geld vorhanden oder der Kurs war so unverschämt hoch, dass man auf die Idee kam, es woanders zu versuchen. Das war allerdings nicht möglich, denn keine Wechselstube wollte diese Währung haben. Kurt und ich nahmen das Geld einfach für unsere nächste Reise mit, was aber verboten war oder wir gaben es für fantastisch gutes und billiges Essen und Getränke aus.
Sofia war genau der richtige Ort dafür.
Zum Beispiel war da das „Hotel Sofia“, dort ging die Post ab. Es gab eine Weinstube mit Musik, Tanz und hervorragendem Essen. Die Zimmer waren eines Fünf-Sterne-Hotels würdig und die Preise stimmten. Es war der richtige Ort, um einen komfortablen Stopp einzulegen. Chitra war sowieso etwas genervt und wollte eine Nacht in einem richtigen Bett schlafen.
Da kam dieser Stopp gerade recht.
Nur die Hotelrechnung mussten wir in Westwährung bezahlen.
Die Trinkerei und das Essen konnte man direkt bei der Kellnerin in Lewa abrechnen. Eine Nacht blieben wir und weiter ging es.
Wir verließen dieses so farblose Land, wo alles grau in grau war und die Leute im Allgemeinen genauso farblos daherkamen. Wie lange mussten diese Menschen noch in diesem System ohne Farbe und ohne Freude, leben? Ohne Glauben? Ohne Hoffnung? „Es lebe der Sozialismus!“
Das hatte mein Cousin damals in Erfurt auch immer gebrüllt, wenn er von der Schule kam und mir imponieren wollte. Nachdem mein Cousin republikflüchtig geworden war und sich im „von den USA unterdrückten Westen“ niedergelassen hatte, ist er heute ein Manager einer großen Energie-Gesellschaft.
Sein Vater hatte sich wieder eine große Bäckerei aufgebaut und war sogar in der Lage, mir viertausend Mark zu leihen, damit ich meine Frau nach Ceylon reisen lassen konnte. Eines Tages würden auch die Menschen im Ostblock frei sein, das hoffte ich wenigstens. Ich dachte, dass es nicht an den Menschen lag, sondern an der Struktur des aufgezwungenen Regierungssystems.
Weiter ging es nach Kapikule, zur türkischen Grenze und nach Edirne. In meinem Pass hatte ich, wie immer und natürlich rein zufällig, einen Zwanzigmarkschein vergessen, den der Zollbeamte sofort konfiszierte. Das half aber dabei, die Zollformalitäten zu beschleunigen. Istanbul mit seinem orientalischen Treiben war eine Stadt, die nie schlief und immer eine Hektik ausstrahlte, dass man froh war, wenn man die asiatische Seite erreicht hatte.
Da es keine Brücke gab, war die Überfahrt nur mit der Fähre möglich.
Auf dem Wege nach Adana gab es viele kleinere und auch größere Lokalitäten, die ein hervorragendes Essen anboten.
Bei den großen Restaurants blieben wir nicht stehen, das waren die Bus-Restaurants. Unsere Stopps machten wir an den kleineren, hauptsächlich von Truckfahrern besuchten Restaurants. Das Essen war garantiert besser und auch billiger.
Ich hatte noch nie ein so gutes Weißbrot gegessen, wie in der Türkei. Ohne Ekmek, so heißt das Brot, aß ich keine Mahlzeit mehr. Dazu gab es Hammelfleisch mit Tomatensoße und frischen grünen Bohnen oder Kichererbsen mit Karotten, Kartoffeln und Rindfleischwürfeln oder Lamm.
Es gab die ganze Palette der Kebab und Döner bis hin zu meiner Leibspeise, dem „Imam Bayaldi“, halbe mit Hackfleisch gefüllte Auberginen. Bis heute sind die türkische und die indische Küche meine absoluten Favoriten. Vor allen Dingen sind die Restaurants gut, in denen die einheimischen Gäste essen. Denn dort, wo auch für Touristen gekocht wird, ist das Essen schon verfälscht.
Ein orientalisches Gericht mit Lamm oder Hammel muss mit Knoblauch zubereitet werden. Und dieses Fleisch muss vollkommen durchgekocht oder -gebraten sein. Man muss es mit einem Löffel essen können. Das Fleisch muss allein vom Knochen fallen, nur so kommt der Geschmack voll zu seiner Entfaltung. Wie es in Deutschland gekocht wird, halb gar wie ein Rinderfilet, kann Lammfleisch oder Hammel nicht schmecken.
Ein indisches „Mutton Curry“, ohne dass das Fleisch durch ist, kann ich mir nicht einmal vorstellen, geschweige denn essen!
Auch was man in den deutschen Dönerbuden bekommt, ist noch lange kein türkisches Essen. Es sind nicht nur die Speisen, auch die Türken hier im Land sind einfach besser und freundlicher als die schon etwas eingedeutschten Türken in Deutschland.
Es ist wie beim Inder, schon alles eingedeutscht.
Beim Inder sollte man auch keinen Kasseler mit Sauerkraut und Semmelklößen bestellen. Wiederum bestelle ich kein Reisgericht beim Deutschen, denn der abgewaschene Beutelreis schmeckt wie aufgekochte Sägespäne.
Chitra war von der orientalischen Küche begeistert und wollte wissen, warum wir Deutsche nur Pfeffer und Salz als Gewürz kennen.
Nie hätte ich gedacht, dass die Esserei einmal so wichtig sein könnte, dass Wohlergehen oder seelischer Zustand dadurch so beeinträchtigt werden.
An der syrischen Grenze musste man mit richtigen Problemen rechnen.
Da lief absolut nichts, ohne das obligatorische Bakschisch.
Wenn den syrischen Beamten etwas nicht passte, stand man tagelang und wartete auf irgendeinen Stempel, der auf einem Dokument fehlte, weil der zuständige Beamte nicht da war. Für zwanzig Dollar konnte man dann aber ohne Stempel weiterfahren. Auch ein syrischer Grenzbeamter hat eine Familie zu ernähren. Die Libanesen sahen alles viel lockerer und hießen uns willkommen. Schon an der Grenze bekam man die ersten Adressen, um das Auto dem Onkel, Neffen oder Bruder anzubieten.
Plötzlich hatte jeder einen Verwandten mit Autowerkstatt und Gebrauchtwagenhandel. Aus Höflichkeit nahm man die Adressen an und so hatte man den Namen des Grenzbeamten, damit sich dieser seine Kommission beim eventuellen Käufer holen konnte.
Doch durch Kurts Bekanntenkreis hatten wir unsere eigenen Adressen.
Der Libanese ist ein cleverer Geschäftsmann und steht dem Juden nicht nach.
Wenn du nicht aufpasst, hat er dich schnell übers Ohr gehauen. Mich hatte noch kein Libanese betrogen, aber nur, weil ich noch nichts gekauft hatte.
Doch ich war auch durchaus bereit, einen Libanesen übers Ohr zu hauen.
Mein Motor war dabei, seinen Geist aufzugeben.
Und das an dem teuer eingekauften Auto!
Also musste ich diesen Wagen unbedingt loswerden. Das Klopfen machte mir Sorgen.
Ein Libanese wollte keinen Motor mit Specht kaufen. Ich erbarmte mich und fütterte den Klopfer im Motor mit Kaffeesatz. In den Motoröl-Einfüllstutzen gab ich den fein gemahlenen Kaffeesatz, schüttete noch einen halben Liter neues Öl hinterher, damit man auch ja kein Körnchen Kaffeesatz sehen konnte, schloss den Deckel und fuhr einmal um die Ecke zu meinem Käufer.
Der gab mir das Geld und ich verschwand mit einem Taxi zum nächsten Einkaufscenter,
damit man meine Spur zum Hotel nicht verfolgen konnte.

Diesem Händler werde ich bestimmt kein Auto mehr verkaufen können. Noch besser wäre es, diesen Stadtteil Beiruts für immer zu meiden. Auch Kurt war sein Auto losgeworden.
Es war in Ordnung.
Beirut, mit den vielen Bars und Nachtklubs, nannte man auch „das Paris des Orients“.
Kurts Freunde hatten uns zu einem Nachtbummel eingeladen. Wir saßen in der Bar vom „King George Hotel“ bei einer Flasche Whisky und einigen leckeren Mezze. Das sind kleine Beispeisen, wie in Spanien die Tapas.
Dies ist ein "BLICK IN MEIN BUCH" gewesen..hier der Link zum Buch:
http://www.amazon.de/Mein-Traum-frei-zu-sein-ebook/dp/B00UU1INXU/ref=tmm_kin_title_0

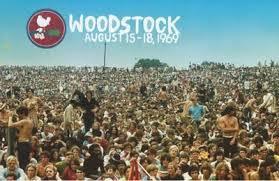
Bild von:Wikipedia
Ich wäre gerne dort gewesen. War das Leben so? Wo war mein Leben geblieben?
Hatte ich schon zu viele Landmanieren angenommen? Ich brauchte eine kleine Auszeit!
Eine Arbeit zu suchen, war ich im Moment nicht in der Lage.
Mit meinem Auto fuhr ich durch die Gegend, bis ich Kurt im „White-Horse-Club“ in Offenbach traf und dieser mich mit seinen palästinensischen Freunden bekannt machte.
Damit begann für mich eine neue Ära. Die Jungen hingen den ganzen Tag in den verschiedenen Kneipen, die sie Cafés nannten, herum. Sie diskutierten den lieben langen Tag und sprachen darüber, wie ungerecht sie von den Israelis und dem Rest der Welt behandelt würden.
Ich sagte ihnen, dass das, was sie da manchmal machten, sehr feige sei und ihnen keine Sympathie in der Welt einbringen würde. Sie müsste der Welt zeigen, dass sie unterdrückt würden, war ihr Argument. Und das ginge nur mit Aufsehen erregenden Geschehnissen, auch ohne, dass ein Palästinenser ums Leben käme.
Ich wusste nicht, was sie auskochten, aber es war mir auch egal. Ich hatte meine eigenen Sorgen.
Kurt kam auf eine Idee und erzählte mir, dass viele von ihnen Autos in den Libanon überführten und dabei gut verdienten. Er selbst hatte schon einige Fahrten mitgemacht und er wollte wissen, ob ich Lust hätte, mit ihm in das Geschäft einzusteigen.
Nach einigen weiteren Gesprächen war es abgemacht, dass wir mit gebrauchten Autos in den Libanon fahren würden. Das musste ich jetzt nur noch meiner Frau beibringen.
Sie hatte doch ihre Mutter, die noch lebende Tote, bei sich und war nicht allein. Die beiden Frauen würden sicher in der Lage sein, unsere kleine Tochter zu erziehen und gut auf sie aufzupassen.
Nach einigen kleineren Diskussionen war Chitra bereit, mir die Chance zu geben und das Auto-Geschäft zu machen. Ich bezahlte die Miete für einen Monat im Voraus. Dabei gab ich das Geld dem Vermieter direkt, nicht meiner Frau. Sie erhielt einen Betrag, der reichte, um Essen zu kaufen und sonst nichts.
Mein Auto verkaufte ich, legte noch etwas Geld dazu und schon hatte ich Startkapital.
Für fünfhundert Mark kaufte ich mit Expertenhilfe von Kurt einen Mercedes 180 Benziner, das gleiche Modell verschaffte sich auch Kurt.
Die Reise nach Beirut klappte wunderbar und ich wurde mein Auto für zweitausend Libanesische Pfund schnell los, was etwa zweitausend Mark gleichkam.
Per Sammeltaxi fuhren wir von Beirut nach Damaskus, von dort ging es mit der Interflug, der DDR-Fluggesellschaft, nach Ostberlin, mit dem Transit-Bus nach Westberlin und dann mit Lufthansa nach Frankfurt. Kontrollen gab es überhaupt nicht.
Die Araber hatten keine Lust zu kontrollieren und die Ostberliner brauchten nicht zu kontrollieren, da wir im Osten nicht aussteigen durften. In Westberlin wurde ebenfalls nicht kontrolliert, weil wir ja aus Ostberlin kamen und was konnte man von dort schon mitbringen? Berlin - Frankfurt war innerdeutsch, also auch keine Kontrolle. Zu jener Zeit waren die palästinensischen Bombenleger noch nicht unterwegs. Das kam erst später.
Das Libanesische Pfund hatte zur Mark den gleichen Wert. Bei meinem Kassensturz stellte ich fest, dass das Geschäft mit den Autos angenehm war.
Nach dem Einkauf und Abzug der Reisekosten hatte ich noch eintausend Mark übrig - das war doch toll! Die ganze Rundreise dauerte vierzehn Tage, das hieß, man konnte zwei Mal pro Monat reisen und würde damit zweitausend Mark verdienen.
Mehr, als mit der Kneipe und mehr, als bei jeder normalen Arbeit.
Natürlich vergaß ich mögliche Risiken, einen Unfall zum Beispiel oder ein Auto, was es nicht ans Ziel schaffen könnte. Auch war ich nicht versichert und zahlte auch nicht in die Rentenkasse ein. Aber wenn man jung ist, kommen diese Überlegungen ganz zum Schluss.
Für den Moment sah ich nur den großen Gewinn, und wenn das ein paar Reisen lang gut ging, konnte ich meine Schulden begleichen und wäre ein freier Mann.
Meine Schulden drückten sehr auf mein Gemüt.
Wie schön musste es doch ohne Schulden sein, dann konnte man wieder machen, was man wollte und musste nicht ständig davonlaufen. Meiner Frau und ihrer Mutter ging es gut, doch nur solange, wie genug Geld im Haus war. Mir war klar geworden, dass im Falle einer Geldknappheit beide nach Ceylon verschwinden würden. Doch ich machte ein paar Reisen und hatte Glück. Alles verlief gut und ich konnte auch meine Gläubiger bezahlen.

Chitra wollte unbedingt eine Fahrt mitmachen und ich erlaubte es.
Sie hatte keinen Führerschein, so mussten wir zu zweit in einem Auto fahren. Diese Reise würde etwas unbequemer werden, der Platz für zwei Personen zum Schlafen im Auto war schon sehr knapp. Und ein Hotel trieb die Kosten in die Höhe. Doch Chitra bettelte so sehr, dass ich keine Chance hatte und sie fuhr mit. Also musste ein Kompromiss her.
Ich kaufte ein größeres Auto, einen 220er Mercedes, der natürlich teurer war, aber beim Verkauf mehr einbringen würde, war doch logisch.
Dann kamen zwei Flugtickets dazu und die doppelte Verpflegung.
Meinen Eltern versprach ich, dass ich sie nach der nächsten Reise besuchen würde. Sie glaubten mir schon gar nichts mehr, und Vater erinnerte mich immer wieder daran, dass ich doch einer geregelten Arbeit nachgehen sollte, schon wegen der Rente.
Scherzhaft antwortete ich ihm, dass Renteneinzahlung verschenktes Geld sei, denn so alt würde ich nicht werden.
Mein gebunkertes Geld hatte ich in einem sicheren Versteck, das Frau und Schwiegermutter nicht kannten.
Im Keller hatte ich eine Kartoffelkiste für gut einen Sack Kartoffeln. Diese Kiste hatte einen doppelten Boden, damit die Luft zirkulieren konnte. Dort hatte ich eine Blechkiste mit meinem Geld. Und ein Sack Kartoffeln lagerte darüber. Wie war das noch einmal? Vertrauen ist gut, doch Verstecken ist besser.
Chitras Mutter, meiner Schwiegermutter, wurde noch einmal ans Herz gelegt, das sie sehr gut auf unsere kleine Tochter aufpassen sollte. Geld hatten wir der Nachbarin gegeben und sie gebeten, ein Auge auf Schwiegermutter und die Kleine zu werfen.
Unsere Reise führte uns durch Salzburg, Graz, Maribor, über die fürchterliche jugoslawische Autopiste, die bis zu einem halben Meter tiefe Schlaglöcher hatte, bis nach Belgrad. Ab Belgrad wurde die Straße besser.
Der Ostblock hatte mich schon immer genervt, da die Menschen dort nicht lebendig wirkten, sie schienen schon tot zu sein, aber hatten es nur noch nicht gemerkt.
Es kam keine Freundlichkeit von ihnen, nur barsche Töne, und immer hatte ich das Gefühl, dass sie in einer ständigen Angst lebten. Vor wem sie Angst hatten, das wusste ich nicht, aber sie machten mir auch Angst.
In allen Ländern hinter dem „Eisernen Vorhang“, ob in Polen, Russland oder einem anderen Ostblock-Land, waren die Menschen immer irgendwie verängstigt. So, als ob man sie täglich verprügeln würde.
Ich fuhr also nur ungern durch Bulgarien, doch es gab keine andere Möglichkeit. Italien und Griechenland waren zu weit und zu teuer. Sofia, Bulgariens Hauptstadt, war sehr schön. Wenn die Bulgaren nicht dort gewesen wären, hätte man sich in diese Stadt verlieben können.
Ich hatte mich schon auf einer meiner vorherigen Reisen verliebt. Nicht in die Stadt, auch hieß sie nicht Sofia, sondern Sofie.
Sie war superhübsch und superschlank, außerdem intelligent und die Botschafterin eines europäischen Staates. Ich schätzte sie als Mittdreißigerin, doch als ich ihr wahres Alter von zweiundfünfzig Jahren hörte, nahm ich Reißaus.
Zu dieser Zeit, mit meinen achtundzwanzig Jahren, war eine Frau über fünfzig schon so viel wie verwest.
Erst später stellte ich fest, wie voreingenommen und blöde ich damals war.
Heute weiß ich, dass eine Frau mit fünfzig grade erst das richtige Alter hat! Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich war also dieses Mal mit Chitra unterwegs und sie hatte auch - wie ich - das diffuse Angstgefühl, wenn die Polizisten in ihren dunklen Uniformen auf freier Straße, ganz plötzlich hinter einem Baum hervorkamen und schrieen, dass man zu schnell gefahren wäre.
Man hatte keine Chance, darauf aufmerksam zu machen, dass sie das gar nicht feststellen könnten, da sie ja kein Radarmessgerät hätten.
Man hörte nur: „Wir Polizei, du zu schnell, du zahlen zwanzig Dollar, Dollar Amerika!“
Wenn man dann erklärte, dass man nur die bulgarischen Lewa hätte, wurde man darauf verwiesen, dass es auch Deutsche Mark sein können aber dann seien fünfzig fällig.
Die wollten keine Lewa, nur Valuta.
Um weiterfahren zu können, kam man nicht drum herum und musste die verlangten Scheine hinblättern. Bestand man darauf, eine Quittung zu bekommen, wurde alles noch komplizierter und der Preis verdoppelte sich. Also keine Quittung und nichts wie weg! Das konnte einem bis zu drei- oder vier Mal am Tag passieren.
Schuld waren die Nummernschilder, das waren deutsche, ovale, weiße Schilder mit schwarzen Zahlen und einem großen „Z“ in der Mitte. Es waren unsere Zollnummernschilder.
Sie waren als „Jumurta Placka“ bekannt.
Das war wohl Türkisch und sollte so viel wie „Eierschild“ heißen. Nicht genug, dass man an der Grenze offiziell bulgarische Lewa zwangsweise tauschen und Benzin-Coupons mit Westwährung kaufen musste.
Wenn man es durch Bulgarien geschafft hatte und an der anderen Grenze seine eingetauschten Lewa zurücktauschen wollte, war entweder kein ausländisches Geld vorhanden oder der Kurs war so unverschämt hoch, dass man auf die Idee kam, es woanders zu versuchen. Das war allerdings nicht möglich, denn keine Wechselstube wollte diese Währung haben. Kurt und ich nahmen das Geld einfach für unsere nächste Reise mit, was aber verboten war oder wir gaben es für fantastisch gutes und billiges Essen und Getränke aus.
Sofia war genau der richtige Ort dafür.
Zum Beispiel war da das „Hotel Sofia“, dort ging die Post ab. Es gab eine Weinstube mit Musik, Tanz und hervorragendem Essen. Die Zimmer waren eines Fünf-Sterne-Hotels würdig und die Preise stimmten. Es war der richtige Ort, um einen komfortablen Stopp einzulegen. Chitra war sowieso etwas genervt und wollte eine Nacht in einem richtigen Bett schlafen.
Da kam dieser Stopp gerade recht.
Nur die Hotelrechnung mussten wir in Westwährung bezahlen.
Die Trinkerei und das Essen konnte man direkt bei der Kellnerin in Lewa abrechnen. Eine Nacht blieben wir und weiter ging es.
Wir verließen dieses so farblose Land, wo alles grau in grau war und die Leute im Allgemeinen genauso farblos daherkamen. Wie lange mussten diese Menschen noch in diesem System ohne Farbe und ohne Freude, leben? Ohne Glauben? Ohne Hoffnung? „Es lebe der Sozialismus!“
Das hatte mein Cousin damals in Erfurt auch immer gebrüllt, wenn er von der Schule kam und mir imponieren wollte. Nachdem mein Cousin republikflüchtig geworden war und sich im „von den USA unterdrückten Westen“ niedergelassen hatte, ist er heute ein Manager einer großen Energie-Gesellschaft.
Sein Vater hatte sich wieder eine große Bäckerei aufgebaut und war sogar in der Lage, mir viertausend Mark zu leihen, damit ich meine Frau nach Ceylon reisen lassen konnte. Eines Tages würden auch die Menschen im Ostblock frei sein, das hoffte ich wenigstens. Ich dachte, dass es nicht an den Menschen lag, sondern an der Struktur des aufgezwungenen Regierungssystems.
Weiter ging es nach Kapikule, zur türkischen Grenze und nach Edirne. In meinem Pass hatte ich, wie immer und natürlich rein zufällig, einen Zwanzigmarkschein vergessen, den der Zollbeamte sofort konfiszierte. Das half aber dabei, die Zollformalitäten zu beschleunigen. Istanbul mit seinem orientalischen Treiben war eine Stadt, die nie schlief und immer eine Hektik ausstrahlte, dass man froh war, wenn man die asiatische Seite erreicht hatte.
Da es keine Brücke gab, war die Überfahrt nur mit der Fähre möglich.
Auf dem Wege nach Adana gab es viele kleinere und auch größere Lokalitäten, die ein hervorragendes Essen anboten.
Bei den großen Restaurants blieben wir nicht stehen, das waren die Bus-Restaurants. Unsere Stopps machten wir an den kleineren, hauptsächlich von Truckfahrern besuchten Restaurants. Das Essen war garantiert besser und auch billiger.
Ich hatte noch nie ein so gutes Weißbrot gegessen, wie in der Türkei. Ohne Ekmek, so heißt das Brot, aß ich keine Mahlzeit mehr. Dazu gab es Hammelfleisch mit Tomatensoße und frischen grünen Bohnen oder Kichererbsen mit Karotten, Kartoffeln und Rindfleischwürfeln oder Lamm.
Es gab die ganze Palette der Kebab und Döner bis hin zu meiner Leibspeise, dem „Imam Bayaldi“, halbe mit Hackfleisch gefüllte Auberginen. Bis heute sind die türkische und die indische Küche meine absoluten Favoriten. Vor allen Dingen sind die Restaurants gut, in denen die einheimischen Gäste essen. Denn dort, wo auch für Touristen gekocht wird, ist das Essen schon verfälscht.
Ein orientalisches Gericht mit Lamm oder Hammel muss mit Knoblauch zubereitet werden. Und dieses Fleisch muss vollkommen durchgekocht oder -gebraten sein. Man muss es mit einem Löffel essen können. Das Fleisch muss allein vom Knochen fallen, nur so kommt der Geschmack voll zu seiner Entfaltung. Wie es in Deutschland gekocht wird, halb gar wie ein Rinderfilet, kann Lammfleisch oder Hammel nicht schmecken.
Ein indisches „Mutton Curry“, ohne dass das Fleisch durch ist, kann ich mir nicht einmal vorstellen, geschweige denn essen!
Auch was man in den deutschen Dönerbuden bekommt, ist noch lange kein türkisches Essen. Es sind nicht nur die Speisen, auch die Türken hier im Land sind einfach besser und freundlicher als die schon etwas eingedeutschten Türken in Deutschland.
Es ist wie beim Inder, schon alles eingedeutscht.
Beim Inder sollte man auch keinen Kasseler mit Sauerkraut und Semmelklößen bestellen. Wiederum bestelle ich kein Reisgericht beim Deutschen, denn der abgewaschene Beutelreis schmeckt wie aufgekochte Sägespäne.
Chitra war von der orientalischen Küche begeistert und wollte wissen, warum wir Deutsche nur Pfeffer und Salz als Gewürz kennen.
Nie hätte ich gedacht, dass die Esserei einmal so wichtig sein könnte, dass Wohlergehen oder seelischer Zustand dadurch so beeinträchtigt werden.

Bild von: Wikipedia
An der syrischen Grenze musste man mit richtigen Problemen rechnen.
Da lief absolut nichts, ohne das obligatorische Bakschisch.
Wenn den syrischen Beamten etwas nicht passte, stand man tagelang und wartete auf irgendeinen Stempel, der auf einem Dokument fehlte, weil der zuständige Beamte nicht da war. Für zwanzig Dollar konnte man dann aber ohne Stempel weiterfahren. Auch ein syrischer Grenzbeamter hat eine Familie zu ernähren. Die Libanesen sahen alles viel lockerer und hießen uns willkommen. Schon an der Grenze bekam man die ersten Adressen, um das Auto dem Onkel, Neffen oder Bruder anzubieten.
Plötzlich hatte jeder einen Verwandten mit Autowerkstatt und Gebrauchtwagenhandel. Aus Höflichkeit nahm man die Adressen an und so hatte man den Namen des Grenzbeamten, damit sich dieser seine Kommission beim eventuellen Käufer holen konnte.
Doch durch Kurts Bekanntenkreis hatten wir unsere eigenen Adressen.
Der Libanese ist ein cleverer Geschäftsmann und steht dem Juden nicht nach.
Wenn du nicht aufpasst, hat er dich schnell übers Ohr gehauen. Mich hatte noch kein Libanese betrogen, aber nur, weil ich noch nichts gekauft hatte.
Doch ich war auch durchaus bereit, einen Libanesen übers Ohr zu hauen.
Mein Motor war dabei, seinen Geist aufzugeben.
Und das an dem teuer eingekauften Auto!
Also musste ich diesen Wagen unbedingt loswerden. Das Klopfen machte mir Sorgen.
Ein Libanese wollte keinen Motor mit Specht kaufen. Ich erbarmte mich und fütterte den Klopfer im Motor mit Kaffeesatz. In den Motoröl-Einfüllstutzen gab ich den fein gemahlenen Kaffeesatz, schüttete noch einen halben Liter neues Öl hinterher, damit man auch ja kein Körnchen Kaffeesatz sehen konnte, schloss den Deckel und fuhr einmal um die Ecke zu meinem Käufer.
Der gab mir das Geld und ich verschwand mit einem Taxi zum nächsten Einkaufscenter,
damit man meine Spur zum Hotel nicht verfolgen konnte.

Diesem Händler werde ich bestimmt kein Auto mehr verkaufen können. Noch besser wäre es, diesen Stadtteil Beiruts für immer zu meiden. Auch Kurt war sein Auto losgeworden.
Es war in Ordnung.
Beirut, mit den vielen Bars und Nachtklubs, nannte man auch „das Paris des Orients“.
Kurts Freunde hatten uns zu einem Nachtbummel eingeladen. Wir saßen in der Bar vom „King George Hotel“ bei einer Flasche Whisky und einigen leckeren Mezze. Das sind kleine Beispeisen, wie in Spanien die Tapas.
Dies ist ein "BLICK IN MEIN BUCH" gewesen..hier der Link zum Buch:
http://www.amazon.de/Mein-Traum-frei-zu-sein-ebook/dp/B00UU1INXU/ref=tmm_kin_title_0
Viel Spass bei der Lektüre!
Wünscht der HIPPIE GURU

