„Du bist besser als ein anderer? Dann will ich dich mal mit einem anderen konfrontieren. Du kennst ihn. Sein Name ist Leroy.“
Peter verschränkte die Arme vor der Brust. „Oh ja, den kenne ich. Aber nur zu, nur zu. Wir werden ja sehen, wer von uns beiden der bessere ist.“
„Leroy wurde in derselben Stadt geboren wie du – nur in einem anderen Viertel. Dort gab es keine Paläste, sondern nur billige Holzhäuser, die alle gleich aussahen. Sie besaßen keine Klimaanlagen und keine europäischen Designermöbel, die Gärten waren ungepflegt, in den Auffahrten standen von Rost zerfressene Autos, ein Schwimmbad besaß auch niemand. Und noch etwas gab es nicht in seinem Viertel: eine gute Schule. Leroy besuchte eine öffentliche Schule, die schlecht ausgestattet war, mit zu wenig Lehrern und veraltetem Lehrmaterial. Und ihm stellte sich noch ein weiteres Problem: Leroy ist ein Schwarzer.“
„Ah, ich weiß schon, was du sagen willst, Helena. Die Schwarzen werden in unserer Gesellschaft unterdrückt, deshalb musste Leroy ein Krimineller werden. Es war alles nicht seine Schuld.“
„Nicht so schnell, Peter. Seine Hautfarbe war für Leroy ein doppeltes Problem. Einerseits, weil es tatsächlich Rassismus in eurer Gesellschaft gibt. Bedenke nur, wie lange es gedauert hat, bis der erste schwarze Präsident gewählt wurde. Andererseits war seine Hautfarbe auch deshalb ein Problem, weil sie eine bequeme Ausrede für ihn darstellte. Während seiner Kindheit kannte er keinen schwarzen Mann in seiner Umgebung, der einer geregelten Arbeit nachging, die meisten lebten von staatlicher Fürsorge oder von kriminellen Aktivitäten. Gelegentlich versuchte jemand, aus diesem Kreislauf auszubrechen, er bewarb sich um eine gute Arbeit oder eine Wohnung in einem besseren Viertel, und wenn er sie nicht bekam, sagte er einfach: Es liegt daran, dass ich ein Schwarzer bin. Diese Leute waren rassistisch gegen sich selbst eingestellt. Leroy übernahm diese Denkmuster, in der Schule strengte er sich nicht an, weshalb er sie ohne Abschluss verlassen musste. Ein Ausweg hat sich ihm jedoch geboten: der Sport. Leroy war ein guter Athlet, sein Talent reichte für mehrere Sportarten. Aber er trainierte nicht hart genug. Er war es nicht gewohnt, morgens früh aufzustehen und einem geregelten Tagesablauf zu folgen. Deshalb zerschlugen sich seine Träume von einer Laufbahn als Profisportler.“
Peter schlug seine Fäuste gegeneinander. „Na bitte. Also war es doch seine Schuld. Er hat Chancen gehabt, aber er hat sie nicht genutzt.“
„Das ist richtig. Leroy hatte seine Situation selbst zu verantworten – aber er lebte ja nicht auf einer einsamen Insel. In Afrika gibt es ein Sprichwort: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. In seinem Fall hat das Dorf versagt.“
„Schau mich nicht so an, Helena. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Er war nicht Teil meines Dorfes.“
„Doch, gewissermaßen gehörtet ihr beide zum selben Dorf. Auf welche Weise genau, wirst du gleich sehen.“
Leroy hatte zwar einen Arbeitsplatz gefunden, doch der entsprach nicht seinen Erwartungen. Er arbeitete bei einem Schnellrestaurant, zehn Stunden am Tag, und erhielt dafür den Mindestlohn, sechs Dollar fünfundfünfzig pro Stunde. Seine Aufgabe bestand darin, Hamburger zuzubereiten – weiter nichts. Während seiner Schicht kam er kaum aus der Küche heraus, immerzu musste er die gleichen Handgriffe wiederholen: Brötchenhälften auseinanderklappen und warm machen, Frikadellen grillen, Senf, Ketchup, Zwiebeln und Gurkenscheiben auf die untere Brötchenhälfte geben, die Frikadelle drauflegen, das Ganze mit der oberen Brötchenhälfte abschließen und in Papier einwickeln. An guten Tagen schaffte er sechshundert Stück. Die einzige Herausforderung bestand darin, einen doppelten oder dreifachen Hamburger zuzubereiten und eine Scheibe Käse oder Speck zwischen die Frikadellen zu legen, auf besonderen Wunsch gab er Röstzwiebeln oder Chilisoße dazu. So verbrachte er seine Tage.
Sein Chef hatte ihn anfangs auch im Verkaufsbereich eingesetzt, doch es stellte sich bald heraus, dass er dafür nicht geeignet war. Leroy konnte nicht mit Menschen umgehen. Entweder wirkte er unfreundlich und mürrisch, oder er verwickelte Kunden – vor allem weibliche – in Privatgespräche, was am Schalter eines Systembetriebes nicht gerne gesehen wird. Also verbannte ihn sein Chef in die Küche – genau so empfand er es, als eine Verbannung an einen schrecklichen Ort, an dem sich allenfalls verurteilte Straftäter aufhalten sollten.
Nur sehr mühsam kam er morgens aus dem Bett heraus, und es kostete ihn große Überwindung, zu seinem Arbeitsplatz zu fahren. Manchmal machte er dabei Umwege, durchquerte die Stadtteile, in denen die Reichen lebten. Er sah ihre riesigen Häuser, die gepflegten Gärten, die Schwimmbäder und Garagen. Leroy wuss-te, dass er sich niemals ein solches Anwesen würde leisten können, nicht mit einem Stundenlohn von sechs Dollar fünfundfünfzig. Dafür brauchte es schon mehr, sehr viel mehr.
Eines Tages kam er an einem Grundstück vorbei, das von einer besonders hohen Mauer umgeben war. Die Mauer schien kein Ende zu nehmen, wurde nur von einem Tor unterbrochen, das aus zwei stählernen Flügeln bestand, Kameras spähten links und rechts auf die Einfahrt herab. Was sich dahinter verbarg, ließ sich nur erahnen; allein die Umrisse eines Daches traten schemenhaft hinter Bäumen hervor. Leroys Neugierde war geweckt.
Für den folgenden Tag dachte er sich einen Trick aus. Er belud den Dachgepäckträger seines Autos mit ein paar Kartons, in die er irgendwelchen Müll stopfte. Genau vor dem Haus mit der hohen Mauer hielt er an und kletterte auf das Autodach, scheinbar, um die Ladung zu kontrollieren und festzuzurren. Insgeheim spionierte er jedoch das Anwesen aus, drei-, viermal blickte er unauffällig zur Seite. Er sah einen kurz geschnittenen Rasen, Ziersträucher und Blumenbeete, dahinter erhob sich eine Villa, zwei Stockwerke, verglaste Eingangsfront. Alles wirkte sauber und gepflegt, nur der Steinhaufen neben der Terrasse störte ein wenig. Leroy schob seine Sonnenbrille hoch, sah genauer hin. Die Steine gehörten zum Schwimmbad, wurde ihm klar, sie bildeten einen künstlichen Hügel, von oben lief Wasser herab, und hinter dem Wasserfall öffnete sich der Eingang zu einer Höhle. Leroy erstarrte für einen Augenblick. Was für ein Luxus, was für ein Leben. Von so etwas hatte er immer geträumt, eine geheime Partyzone, in die man sich zurückziehen konnte, wo man sich Vergnügungen aller Art hingeben konnte. Wie schön wäre es, wenn ihm das Haus gehören würde, wenn er seine Freunde dorthin einladen könnte… Sechs Dollar fünfundfünfzig.
Am liebsten hätte er laut geschrieen. Aber das hätte ihn auch nicht weitergebracht. Leroy beschloss, sich seinen Anteil vom Leben zu holen. Wenn es auf die eine Art nicht funktionierte, dann eben auf die andere. Schon einmal hatte er versucht, in ein Haus einzubrechen. Vor drei Monaten war es, Leroy wollte gemeinsam mit einem Freund dessen ehemaligen Chef ausrauben. Sie verhielten sich jedoch ziemlich unprofessionell, kletterten nachts über einen Zaun und scheiterten schon wenige Minuten später, weil sie zwar einen nachgemachten Schlüssel für die Garage besaßen, aber nicht mit dem Bewegungsmelder gerechnet hatten. Die Alarmanlage schlug an, heulte und blinkte, und sie liefen davon, versteckten sich unter einer Brücke, wo sie für den Rest der Nacht zitternd auf dem Boden hockten, weil sie glaubten, die Polizei wäre ihnen auf den Fersen.
Diesmal wollte er es besser machen. Und er wollte es allein machen, sein Freund hatte sich als Feigling erwiesen, der zudem falsche Informationen lieferte. Leroy stellte selbst Nachforschungen an, er sprach mit Leuten, die schon mal im Gefängnis waren, die sich mit diesen Dingen auskannten. Sie gaben ihm Tipps, wertvolle Tipps, wie er dachte. Nachts kam man in die Häuser der Reichen nicht hinein, sie waren zu gut gesichert, mit Sicherheitstüren und –fenstern, mit Kameras und Alarmanlagen. Tagsüber waren diese Anlagen jedoch meist abgeschaltet, die Leute verhielten sich sorglos – darin sah er seine Chance. Er entwickelte einen Plan.
Vom Sperrmüll holte er sich einen Koffer und einen Overall, die beide mit Namen und Symbol eines Unternehmens bedruckt waren, das nicht mehr existierte. In einem großen Supermarkt kaufte er einen Kescher, der eigentlich für Sportangler gedacht war. Mit dieser Ausrüstung wollte Leroy den Eindruck erwecken, er sei für die Reinigung von Schwimmbecken zuständig. Solche Leute sah man häufig in den Vierteln der Reichen, niemand würde Verdacht schöpfen, wenn er eine Adresse suchen oder sich vielleicht sogar auf dem falschen Grundstück aufhalten würde. Er könnte dann immer noch behaupten, er hätte sich in der Hausnummer geirrt. Der Plan erschien ihm narrensicher. Und für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte, besorgte er sich eine Pistole. Noch einmal wollte er nicht vor der Polizei davonlaufen und eine ganze Nacht zitternd in einer dunklen Ecke verbringen.
Zunächst machte er weiter wie bisher. Morgens stand er auf, fuhr zu dem Schnellrestaurant und ging seiner Arbeit nach. Allerdings begann er seinen Tag früher als sonst, er zog den Overall an und nahm weite Umwege. Leroy hatte verschiedene Routen ausgearbeitet, an denen Häuser lagen, die einen Besuch lohnten. Der Plan schien aufzugehen. Bei seinem ersten Einbruch raubte er Unterhaltungselektronik im Wert von mehreren Tausend Dollar. Alles lief sehr schnell ab, er parkte seinen Wagen einen Block entfernt, ging zum Zielobjekt, tat so, als würde er den Pool reinigen, betrat das Haus durch eine offene Terrassentür, packte die Geräte in seinen Koffer und verschwand wieder. Unterwegs traf er eine Hausangestellte, wahrscheinlich eine mexikanische Köchin; sie grüßte ihn freundlich, er grüßte ebenso freundlich zurück. Im Auto lachte er über sein Gaunerstück.
Fortsetzung folgt.
Unter diesem Link finden Sie die bisher erschienen Teile.
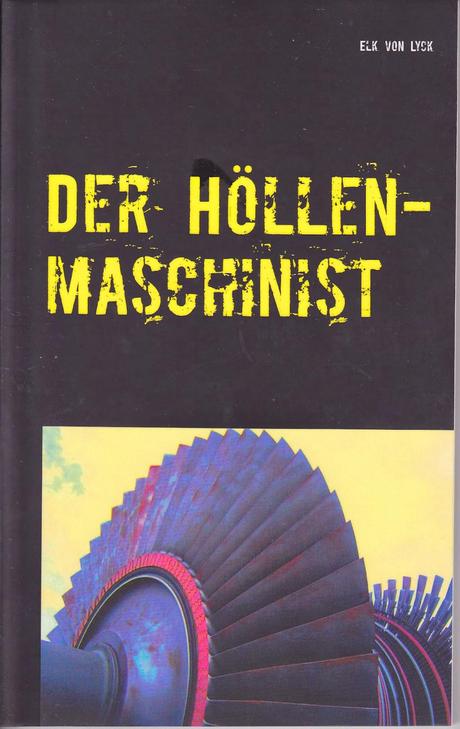
Sie können natürlich auch das komplette Buch kaufen.
Der Höllenmaschinist - Erzählung
2. Auflage
112 Seiten Gedrucktes Buch EUR 7,90 E-Book EUR 3,99
Erhältlich u.a. bei Amazon
Peter verschränkte die Arme vor der Brust. „Oh ja, den kenne ich. Aber nur zu, nur zu. Wir werden ja sehen, wer von uns beiden der bessere ist.“
„Leroy wurde in derselben Stadt geboren wie du – nur in einem anderen Viertel. Dort gab es keine Paläste, sondern nur billige Holzhäuser, die alle gleich aussahen. Sie besaßen keine Klimaanlagen und keine europäischen Designermöbel, die Gärten waren ungepflegt, in den Auffahrten standen von Rost zerfressene Autos, ein Schwimmbad besaß auch niemand. Und noch etwas gab es nicht in seinem Viertel: eine gute Schule. Leroy besuchte eine öffentliche Schule, die schlecht ausgestattet war, mit zu wenig Lehrern und veraltetem Lehrmaterial. Und ihm stellte sich noch ein weiteres Problem: Leroy ist ein Schwarzer.“
„Ah, ich weiß schon, was du sagen willst, Helena. Die Schwarzen werden in unserer Gesellschaft unterdrückt, deshalb musste Leroy ein Krimineller werden. Es war alles nicht seine Schuld.“
„Nicht so schnell, Peter. Seine Hautfarbe war für Leroy ein doppeltes Problem. Einerseits, weil es tatsächlich Rassismus in eurer Gesellschaft gibt. Bedenke nur, wie lange es gedauert hat, bis der erste schwarze Präsident gewählt wurde. Andererseits war seine Hautfarbe auch deshalb ein Problem, weil sie eine bequeme Ausrede für ihn darstellte. Während seiner Kindheit kannte er keinen schwarzen Mann in seiner Umgebung, der einer geregelten Arbeit nachging, die meisten lebten von staatlicher Fürsorge oder von kriminellen Aktivitäten. Gelegentlich versuchte jemand, aus diesem Kreislauf auszubrechen, er bewarb sich um eine gute Arbeit oder eine Wohnung in einem besseren Viertel, und wenn er sie nicht bekam, sagte er einfach: Es liegt daran, dass ich ein Schwarzer bin. Diese Leute waren rassistisch gegen sich selbst eingestellt. Leroy übernahm diese Denkmuster, in der Schule strengte er sich nicht an, weshalb er sie ohne Abschluss verlassen musste. Ein Ausweg hat sich ihm jedoch geboten: der Sport. Leroy war ein guter Athlet, sein Talent reichte für mehrere Sportarten. Aber er trainierte nicht hart genug. Er war es nicht gewohnt, morgens früh aufzustehen und einem geregelten Tagesablauf zu folgen. Deshalb zerschlugen sich seine Träume von einer Laufbahn als Profisportler.“
Peter schlug seine Fäuste gegeneinander. „Na bitte. Also war es doch seine Schuld. Er hat Chancen gehabt, aber er hat sie nicht genutzt.“
„Das ist richtig. Leroy hatte seine Situation selbst zu verantworten – aber er lebte ja nicht auf einer einsamen Insel. In Afrika gibt es ein Sprichwort: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. In seinem Fall hat das Dorf versagt.“
„Schau mich nicht so an, Helena. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Er war nicht Teil meines Dorfes.“
„Doch, gewissermaßen gehörtet ihr beide zum selben Dorf. Auf welche Weise genau, wirst du gleich sehen.“
Leroy hatte zwar einen Arbeitsplatz gefunden, doch der entsprach nicht seinen Erwartungen. Er arbeitete bei einem Schnellrestaurant, zehn Stunden am Tag, und erhielt dafür den Mindestlohn, sechs Dollar fünfundfünfzig pro Stunde. Seine Aufgabe bestand darin, Hamburger zuzubereiten – weiter nichts. Während seiner Schicht kam er kaum aus der Küche heraus, immerzu musste er die gleichen Handgriffe wiederholen: Brötchenhälften auseinanderklappen und warm machen, Frikadellen grillen, Senf, Ketchup, Zwiebeln und Gurkenscheiben auf die untere Brötchenhälfte geben, die Frikadelle drauflegen, das Ganze mit der oberen Brötchenhälfte abschließen und in Papier einwickeln. An guten Tagen schaffte er sechshundert Stück. Die einzige Herausforderung bestand darin, einen doppelten oder dreifachen Hamburger zuzubereiten und eine Scheibe Käse oder Speck zwischen die Frikadellen zu legen, auf besonderen Wunsch gab er Röstzwiebeln oder Chilisoße dazu. So verbrachte er seine Tage.
Sein Chef hatte ihn anfangs auch im Verkaufsbereich eingesetzt, doch es stellte sich bald heraus, dass er dafür nicht geeignet war. Leroy konnte nicht mit Menschen umgehen. Entweder wirkte er unfreundlich und mürrisch, oder er verwickelte Kunden – vor allem weibliche – in Privatgespräche, was am Schalter eines Systembetriebes nicht gerne gesehen wird. Also verbannte ihn sein Chef in die Küche – genau so empfand er es, als eine Verbannung an einen schrecklichen Ort, an dem sich allenfalls verurteilte Straftäter aufhalten sollten.
Nur sehr mühsam kam er morgens aus dem Bett heraus, und es kostete ihn große Überwindung, zu seinem Arbeitsplatz zu fahren. Manchmal machte er dabei Umwege, durchquerte die Stadtteile, in denen die Reichen lebten. Er sah ihre riesigen Häuser, die gepflegten Gärten, die Schwimmbäder und Garagen. Leroy wuss-te, dass er sich niemals ein solches Anwesen würde leisten können, nicht mit einem Stundenlohn von sechs Dollar fünfundfünfzig. Dafür brauchte es schon mehr, sehr viel mehr.
Eines Tages kam er an einem Grundstück vorbei, das von einer besonders hohen Mauer umgeben war. Die Mauer schien kein Ende zu nehmen, wurde nur von einem Tor unterbrochen, das aus zwei stählernen Flügeln bestand, Kameras spähten links und rechts auf die Einfahrt herab. Was sich dahinter verbarg, ließ sich nur erahnen; allein die Umrisse eines Daches traten schemenhaft hinter Bäumen hervor. Leroys Neugierde war geweckt.
Für den folgenden Tag dachte er sich einen Trick aus. Er belud den Dachgepäckträger seines Autos mit ein paar Kartons, in die er irgendwelchen Müll stopfte. Genau vor dem Haus mit der hohen Mauer hielt er an und kletterte auf das Autodach, scheinbar, um die Ladung zu kontrollieren und festzuzurren. Insgeheim spionierte er jedoch das Anwesen aus, drei-, viermal blickte er unauffällig zur Seite. Er sah einen kurz geschnittenen Rasen, Ziersträucher und Blumenbeete, dahinter erhob sich eine Villa, zwei Stockwerke, verglaste Eingangsfront. Alles wirkte sauber und gepflegt, nur der Steinhaufen neben der Terrasse störte ein wenig. Leroy schob seine Sonnenbrille hoch, sah genauer hin. Die Steine gehörten zum Schwimmbad, wurde ihm klar, sie bildeten einen künstlichen Hügel, von oben lief Wasser herab, und hinter dem Wasserfall öffnete sich der Eingang zu einer Höhle. Leroy erstarrte für einen Augenblick. Was für ein Luxus, was für ein Leben. Von so etwas hatte er immer geträumt, eine geheime Partyzone, in die man sich zurückziehen konnte, wo man sich Vergnügungen aller Art hingeben konnte. Wie schön wäre es, wenn ihm das Haus gehören würde, wenn er seine Freunde dorthin einladen könnte… Sechs Dollar fünfundfünfzig.
Am liebsten hätte er laut geschrieen. Aber das hätte ihn auch nicht weitergebracht. Leroy beschloss, sich seinen Anteil vom Leben zu holen. Wenn es auf die eine Art nicht funktionierte, dann eben auf die andere. Schon einmal hatte er versucht, in ein Haus einzubrechen. Vor drei Monaten war es, Leroy wollte gemeinsam mit einem Freund dessen ehemaligen Chef ausrauben. Sie verhielten sich jedoch ziemlich unprofessionell, kletterten nachts über einen Zaun und scheiterten schon wenige Minuten später, weil sie zwar einen nachgemachten Schlüssel für die Garage besaßen, aber nicht mit dem Bewegungsmelder gerechnet hatten. Die Alarmanlage schlug an, heulte und blinkte, und sie liefen davon, versteckten sich unter einer Brücke, wo sie für den Rest der Nacht zitternd auf dem Boden hockten, weil sie glaubten, die Polizei wäre ihnen auf den Fersen.
Diesmal wollte er es besser machen. Und er wollte es allein machen, sein Freund hatte sich als Feigling erwiesen, der zudem falsche Informationen lieferte. Leroy stellte selbst Nachforschungen an, er sprach mit Leuten, die schon mal im Gefängnis waren, die sich mit diesen Dingen auskannten. Sie gaben ihm Tipps, wertvolle Tipps, wie er dachte. Nachts kam man in die Häuser der Reichen nicht hinein, sie waren zu gut gesichert, mit Sicherheitstüren und –fenstern, mit Kameras und Alarmanlagen. Tagsüber waren diese Anlagen jedoch meist abgeschaltet, die Leute verhielten sich sorglos – darin sah er seine Chance. Er entwickelte einen Plan.
Vom Sperrmüll holte er sich einen Koffer und einen Overall, die beide mit Namen und Symbol eines Unternehmens bedruckt waren, das nicht mehr existierte. In einem großen Supermarkt kaufte er einen Kescher, der eigentlich für Sportangler gedacht war. Mit dieser Ausrüstung wollte Leroy den Eindruck erwecken, er sei für die Reinigung von Schwimmbecken zuständig. Solche Leute sah man häufig in den Vierteln der Reichen, niemand würde Verdacht schöpfen, wenn er eine Adresse suchen oder sich vielleicht sogar auf dem falschen Grundstück aufhalten würde. Er könnte dann immer noch behaupten, er hätte sich in der Hausnummer geirrt. Der Plan erschien ihm narrensicher. Und für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte, besorgte er sich eine Pistole. Noch einmal wollte er nicht vor der Polizei davonlaufen und eine ganze Nacht zitternd in einer dunklen Ecke verbringen.
Zunächst machte er weiter wie bisher. Morgens stand er auf, fuhr zu dem Schnellrestaurant und ging seiner Arbeit nach. Allerdings begann er seinen Tag früher als sonst, er zog den Overall an und nahm weite Umwege. Leroy hatte verschiedene Routen ausgearbeitet, an denen Häuser lagen, die einen Besuch lohnten. Der Plan schien aufzugehen. Bei seinem ersten Einbruch raubte er Unterhaltungselektronik im Wert von mehreren Tausend Dollar. Alles lief sehr schnell ab, er parkte seinen Wagen einen Block entfernt, ging zum Zielobjekt, tat so, als würde er den Pool reinigen, betrat das Haus durch eine offene Terrassentür, packte die Geräte in seinen Koffer und verschwand wieder. Unterwegs traf er eine Hausangestellte, wahrscheinlich eine mexikanische Köchin; sie grüßte ihn freundlich, er grüßte ebenso freundlich zurück. Im Auto lachte er über sein Gaunerstück.
Fortsetzung folgt.
Unter diesem Link finden Sie die bisher erschienen Teile.
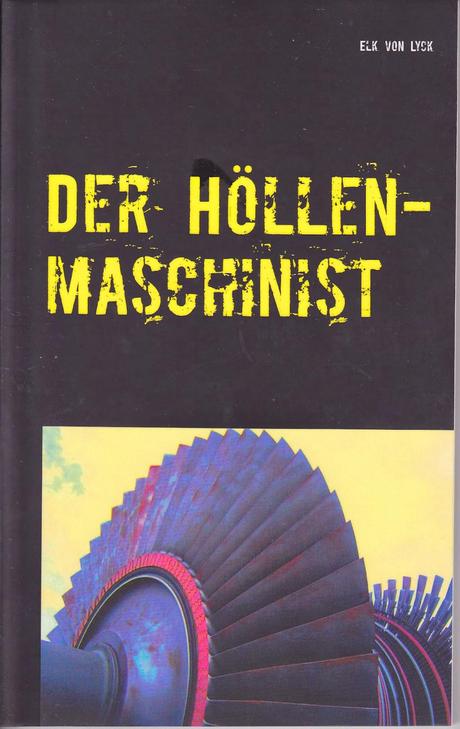
Sie können natürlich auch das komplette Buch kaufen.
Der Höllenmaschinist - Erzählung
2. Auflage
112 Seiten Gedrucktes Buch EUR 7,90 E-Book EUR 3,99
Erhältlich u.a. bei Amazon


