Es wird viel diskutiert, umgesetzt, ausprobiert und besprochen: Der bedürfnis – und bindungsorientierte Umgang von Eltern und Kindern ist ein aktuelles Thema.
Ein Mensch, der in seinem So-Sein angenommen wird und dessen Bedürfnisse wahrgenommen werden, entwickelt sich zu einem selbstsicheren Wesen. So – sehr kurz umrissen – die grundsätzliche und begrüßenswerte Idee.
Es gibt nichts Wichtigeres für ein neugeborenes Kind als Nähe, Wärme, Liebe und Sicherheit. Nur so bauen wir Menschen Urvertrauen auf. Eine unzureichende oder unzuverlässige Zuwendung hinterlässt Spuren.
Wir liebenden und aufmerksamen Eltern möchten für unsere Kinder den bestmöglichen Start in das Leben. Damit dieser später ein gesundes Fundament für die kindliche Seele bildet.
Geborgenheit und Liebe, ein warmes Nest und Zuwendung ist, was kleine Menschen zunächst brauchen. Werden sie größer, ist es an der Zeit, ihnen Freiräume zu geben. Sie selbstständig werden zu lassen. Unsere Kinder gehören uns nicht. Wir dürfen dankbar sein, dass sie uns anvertraut wurden. Sie sollen sich frei entfalten können.

Aus dieser Dankbarkeit sollte ein Grundrespekt erwachsen. Und aus diesem eine absolut individuelle Betrachtung der Familienmitglieder.
Es wird so oft gesagt und geschrieben – man kann es jedoch nicht oft genug betonen:
Jede Familie geht ihren Weg. Es gibt kein Anleitungsbuch für alle. Daher bin ich sicher, dass eine fertige Liste für alle zum Abhaken niemals der richtige Weg ist. Ich persönlich habe tiefes Vertrauen in alle Eltern, die sich verständnisvolle Gedanken um ihre Kinder machen: Sie gehen einen liebevollen Weg und sind in der Lage, vertrauensvoll zu kommunizieren.
Instinkt und erste Erfahrungen
Ich habe instinktiv vor fast 14 Jahren diesen Weg gewählt: Die individuellen Bedürfnisse des Kindes wurden stets wahrgenommen. Erst beim vierten Kind und mit fast vierzig Jahren jedoch bin ich erst in der Lage, dies in einer Tiefe zu tun, die ich selbst als erfüllend bezeichnen würde.
Ich verstehe unter Bindung – und Bedürfnisorientierung eine emotionale und zugleich reflektierte Geisteshaltung:
Ich habe im besten Fall hierbei – und das ist absolut wichtig – nicht nur die Gefühle meiner Kinder im Blick, sondern auch meine eigenen: Ich muss genau unterscheiden können, was ich für meine Kinder tue und ob ich vielleicht nur (unbewusste, eigene) Bedürfnisse in sie hineininterpretiere. Natürlich ist jedes Kind anders und es kann nicht alles für jedes passen. Und diese Basis alleine ist schon sehr fragil und schwierig.
Mir fiel beim jahrelangen Beobachten der Thematik Einiges auf:
- Man muss sich vor der Geburt des ersten Kindes sicher und klar sein, dass diese Art der Begleitung voraussetzt, dass man sich komplett von alten (selbst erfahrenen) Erziehungsmustern gelöst hat oder lösen wird. Man kann einem Kind, zu dem man eine vertrauensvolle und respektvolle Bindung („auf Augenhöhe“) hat, nicht plötzlich sagen: „Oar, das ist schon wieder falsch, gib dir mal Mühe!“ oder „Es reicht mir! Du machst das jetzt, weil ich es sage!“ Es ist wenig sinnvoll, das Kind plötzlich nicht mehr da abzuholen wo es steht, sondern in alte Muster zu verfallen und vorübergehend auf einen hierarchischen Umgang umzustellen.
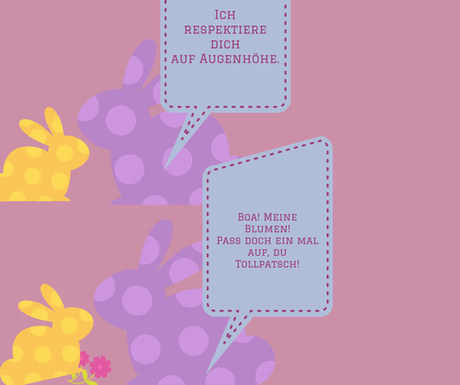
- Zugleich wird man immer wieder merken: Kinder wünschen Grenzen und Autorität – es ist unglaublich schwierig, langfristig eine Balance zu finden. Man muss einfach damit zurechtkommen, dass man andauernd neu austarieren und reflektieren muss. Das wiederum bietet aber auch Potential für eigene Entwicklungsschritte.
- Diese Art des Umgangs eignet sich in aller Konsequenz eigentlich nur, wenn man wenige Kinder hat. Oder mehrere, dafür aber wirklich sehr gut darin ist, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und vor allem auch zu befriedigen. Letzteres ist unerlässlich, da Kinder zum Einen nach Vorbild leben und zum Anderen sicherlich einen nicht förderlichen charakterlichen Weg einschlagen, wenn ihre Bedürfnisse auch nach dem Kleinkindalter noch die allerwichtigsten der gesamten Familie sind.
- Man muss weit entfernt vom Mutter-Mythos leben. Die „aufopferungsvolle, selbstlose Mutter“ ist die Antagonistin einer Frau, die zu den Kindern eine Beziehung auf Augenhöhe führen möchte. Schnell verliert sie sich zwischen den Bedürfnissen ihres Babies und des Kleinkindes. Und das kann sie kaum mehr stoppen. (Been there, done that …)
- Kindliche Bedürfnisse sind nicht nur Wärme, Liebe, Vertrauen, Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit und Co. Sondern auch emotionale Eigenständigkeit, Selbstständigkeit (im Alltag), Sich ausprobieren dürfen, Abnabeln, Grenzen spüren, sich am Gegenüber emotional reiben und in ihm spiegeln können, Anleitung finden. Man muss in aller Konsequenz bereit sein, auch diesen nachzugehen. Es kann schwierig sein, das kleine Mäuschen, das nachts in Mamas Arm schläft, am Morgen gleich mal alleine auf das höchste Klettergerüst zu lassen. Und es kann beispielsweise ebenso heftig sein, in einer engen Bindung belogen zu werden, dies darf man nicht persönlich nehmen, sondern das hinter der Lüge stehende Bedürfnis wahrnehmen. Im Grunde ist Attachment Parenting „für Babies und Kleinkinder gemacht“ – so las ich das neulich. Und da ist sicher etwas dran. Allerdings kann man es fortsetzen und das kommt nicht nur den Kindern zu Gute, wenn man bestimmte Punkte beachtet.
- Die Eltern müssen beide mit diesem Stil des Umgangs vollkommen einverstanden sein.
- Bedürfnisse äußern sich auf unterschiedliche Weisen. Und diese sind bekanntlich nicht immer angenehm. Man braucht innere Ausgeglichenheit, um auf die emotionalen Bedürfnisse gut eingehen und sie richtig einschätzen zu können.
- Wenn man viele Kinder hat und wenig Unterstützung, dann ist das Leben anstrengend. Wenn man hier nun nicht auf seine eigene Bedürfnisbalance achtet, dann geht man unter. Aufopferung und Bindungsorientierung gehören nicht zusammen! Kindern soll nicht vermittelt werden „Solange du klein bist, nehmen deine Mitmenschen dich wahr, wenn du groß bist, darfst du deine Bedürfnisse auf den Müll werfen – so wie ich. Also werde lieber eine Petra oder ein Peter Pan.“
- Selbstreflexion und Beobachtung der Familie ist wichtig, damit man nicht jedes Bedürfnislein sofort umsetzt („Eis! Aufmerksamkeit! Kuchen! Riesengeburtstagsparty!“) – denn das ist es, was aus einem Menschen einen selbstverliebten Dorian Gray macht, der seine Eltern irgendwann wütend ablehnt, wenn diese Rundumversorgung endet (mit dem eigenen Auszug, der frustrierten Mutter im Streik oder einer späten Einsicht der Eltern)
Bedürfnisse sind sehr individuell
Ich beschreibe hier meine persönlichen Erfahrungen mit unseren vier Kindern während der ersten Jahre:
Als ich 2002 Mutter wurde, gab es die Begriffe Attachment Parenting oder Bindungsorientierte Erziehung nicht. Zumindest nicht in meinem Umfeld und auch bis heute haben überwiegend internetaffine Eltern damit zu tun – so kommt es mir vor. Ich habe bisher nur zwei Mütter analog getroffen, die wussten, was das ist.
Und zugleich möchte ich anmerken, dass ich die klassischen Eckpunkte Familienbett/Langzeitstillen/Tragen etc. nicht oder aus sich ergebenden Bedürfnissen und Möglichkeiten nur eingeschränkt umgesetzt habe. Das wiederum gelte lediglich als Disclaimer. Ich bin mit meinen Entscheidungen dahingehend vollkommen d’accord, denn man kann seine Kinder ganz genau so bindungsorientiert begleiten, wenn man nicht langzeitstillt oder zusammen schläft. Es ist zudem eine emotionale, individuelle (und wissenschaftlich mehrfach belegte) Angelegenheit, auf welche Weisen man Bindung entstehen lässt. Ich habe sogar Zweifel daran, dass sie nötig sind, obwohl ich sie überwiegend befürworte. Denn das Wichtigste, so glaube ich, sind eine vertrauensvolle Kommunikation sowie ein empathischer Umgang miteinander.
Unsere Nummer 1 schlief im Jahr 2002 natürlich neben unserem Bett in ihrem Bettchen – wir wollten sie bei uns in der Nähe haben. Gut, ich bekam kein Auge zu, weil der Gedanke, jederzeit von nur einem Schnaufen geweckt zu werden,eine nervöse Person mich eben vom Schlafen abhält. Ich fand es allerdings mehr als süß, meinen ganzen Stolz neben mir liegen zu sehen. Gern hätte ich sie mit ins Bett genommen, aber davor warnten mich Hebammen und Ärztin. Und auch mein Instinkt riet mir ab.
Nummer 1 war unruhig und sehr fordernd. Sie wurde mehr und mehr zu einem Schreibaby – ich stand innerlich unter Daueranspannung (später erst sollte ich begreifen, dass dies der Grundzustand der meisten Mütter während der ersten Jahre mit Kindern ist). Und meine Tochter anscheinend auch. Wir stressten uns gegenseitig. Jedoch war ihr Vater eher ausgeglichen und auf ihn reagierte sie ähnlich. Ich ahnte, dass ich ihr nicht ganz geben konnte, was sie brauchte – allein schon, weil ich einfach nicht herausbekam, was das war. Ich probierte daher Verschiedenes aus und lernte sie dadurch besser kennen. Ich erlernte ihre ganz eigene Sprache, in dem ich genau auf ihre Mimik und Gestik achtete.
Das Stillen fand ich furchtbar. Ich hasste es. (Hierzu werde ich bald einen eigenen Artikel verfassen, gemeinsam mit Jana vom Hebammenblog. Thema: „Wie fühlen sich Geburt und Stillen für Frauen an, die sexuelle Gewalt erlebten?“ Ich kann hier schon mal verraten: Es ist nicht so dolle.) Ich tat es natürlich dennoch, da es für mich zum Grundbedürfnis kleiner und besonders eben sehr kleiner Menschen gehört. Ich hätte es nur auch sehr gerne genossen. Stattdessen kippte ich regelmäßig, nachdem mein kleiner Barracuda meine Brüste binnen 5 Minuten beidseitig gelehrt hatte, wie das Opfer einer vampirischen Attacke auf das Sofa um und fühlte mich deliriös. Und dazu kam der psychische Stress, den das Stillen für mich bedeutete. (Das hat sich übrigens bis zum vierten Kind auch nicht geändert.)
Die Hebamme erwartete allerdings mit üblichem Druck von mir, ausgiebig zu stillen und als mein Instinkt mir sagte, die Trinkdauer sei zu kurz und das Kind anschließend zu unruhig, empfahl sie mir einfach durchzuhalten, noch öfter anzulegen und viel zu trinken. (Bis Nummer 1 Untergewicht hatte, mir ihr anhaltendes, verständliches Weinen den letzten Nerv raubte und ich letztlich nach 7 Monaten zufüttern musste).
Mir war es wichtig zu spüren, was mein Kind braucht. Ich stellte fest, dass dieses Kind, das tagsüber niemals mehr als zwei Stunden schlief und dennoch die Nacht zum Tage machte, etwas innerlich Getriebenes an sich hatte. Nummer 1 wollte immer mehr als sie konnte. Ich hatte bald begriffen: Dieses Kind wird erst zufrieden sein, wenn es laufen kann. Bis dahin müssen wir die Zeit überbrücken. Und mein oberstes Ziel war es, das Schreien meines Babies zu vermeiden, indem ich las, was es brauchte. Leider ließ sich ein Baby wie Nummer 1, das die Standardkriterien eines Schreikindes erfüllte, davon nicht immer so gut abhalten.
Nummer 1 war ungern im Kinderwagen aber gerne im Tragetuch oder der Tragehilfe. Sie mochte überhaupt körperliche Nähe nur in Form von Tragen. Also trug ich. Drückte oder küsste ich sie, wendete sie sich ab oder stemmte die Arme gegen mich.
Selbstverständlich ließ ich das sein. Ich gab ihr Nähe auf Distanz und wir scherzten, es sei mit diesem Mädchen, wie einen Kaktus zu umarmen. Wir akzeptierten es und ich respektierte ihre Gefühle. Sie fühlte sich in der Tat zufriedener als sie laufen konnte. Sie mochte es, die Kontrolle über ihren Aufenthaltsort zu haben. Sie war ein echtes „Äffchen“: Liebte es, wenn man mit ihr herumturnte und Blödsinn machte – stets humorvoll und lustig.

Mit rund zwei Jahren kam die erste Autonomiephase. Ich ließ ihren Gefühle Raum. lenkte bisweilen um, begrenzte, wenn sie es brauchte. Und wir hatten selten Probleme miteinander. Ich kenne kein „Ich will den blauen Becher! Aaaaaaah!“, keine Wutausbrüche. Ich habe mich immer daran gehalten, dass ein Mensch, der sich gerade „anstrengend“ oder „unangenehm“ zeigt, etwas mehr gute Gefühle braucht und diese habe ich dann gegeben, um eine Balance herzustellen. Etwas Akzeptierendes wie „Du bist gerade wütend. Okay. Kann ich dir helfen? Nein? Auch okay“ hat bei ihr unterstützend gewirkt.
Inzwischen war Nummer 2 geboren und ich lernte ein Baby kennen, das in sich ruhte und sehr anhänglich war. Nummer 2 wurde von einem Familienfreund „Little Buddha“ genannt. Auch, weil sie fast 4 Kilo wog auf 50 Zentimetern. Vor allem aber, weil sie zufrieden wirkte. Sie wuchs zufrieden vor sich hin und wollte eher beobachten als mitzumischen. Mit ihr konnte man nicht herumaffen – dann erschrak sie. Sie bewegte sich manchmal wie in Zeitlupe – daher nannten wir sie eine kleine Schildkröte.

Während Nummer 1 körperlich sehr geschickt war und niemals ein Fleckchen auf ihrem Kleidchen hinterlassen wollte, war Nummer 2 eher tollpatschig und wenig in ihrem Körper zu Hause. Irgendwie war sie immer verschmiert und ihre Klamotten dreckig: Sie war eine klassische Denkerin. Begann mit acht Monaten zu sprechen und „erst“ mit 15 Monaten holperig zu laufen. Dafür las sie dann mit 5 bereits fließend, nachdem sie es sich selbst beigebracht hatte.
Ich gab ihr viel Nähe und Zärtlichkeit, während Nummer 1 es eher mochte, mich nur in der Nähe zu sehen, um sich sicher zu fühlen.
Es gab keine Eifersucht zwischen den beiden: Ich hatte Nummer 1 während der Schwangerschaft nicht auf eine Spielkameradin vorbereitet, sondern auf ein pflegebedürftiges Baby. Und um dieses durfte sie – als ehrenwerte große Schwester – sich kümmern. Sie war eben die Größere und auf Grund dieses sicheren Gefühls (das definitiv eine Spur Überlegenheit enthalten durfte), akzeptierte sie ihre Schwester mit sehr viel Liebe und vor allem Verständnis. Sie lernte rasch, sich zurückzunehmen und ihre eigenen Bedürfnisse auch mal aufschieben zu müssen zu Gunsten eines noch kleineren Kindes, das noch nicht warten konnte. Ich zollte ihr meine Anerkennung und sie fühlte sich gut.
Nummer 2 wurde viel mehr getragen, gekuschelt und abgeknutscht – weil es ihr so gut gefiel. Sie forderte zugleich weniger Autonomie ein. Sie war ein Speikind und so mussten wir beide mehrmals täglich die Klamotten wechseln. Zum Einschlafen lag sie in einem Stubenwagen neben dem Elternbett, wo sie abends im Halbschlaf circa 2 Stunden lang vor sich hin brummte, ehe sie richtig einschlief. Zuvor lag mein Mann immer eine Stunde mit ihr kuschend auf dem Sofa: „Auf die Couch gepinnt werden“ nannte er das und es war auf die Dauer ein zunehmend einseitiges Vergnügen.
Ich unternahm mit den beiden Kindern immer öfter etwas. Nummer 1 liebte frische Luft und Bewegung. Nummer 2 liebte Liegen und Beobachten. Beide bekamen, was sie brauchten. Nummer 2 entwickelte sich zu einem wissbegierigen Kind mit sehr langen Frageketten, die ich ausnahmslos und immer beantwortete. Sie gierte nach Informationen, schloss Zusammenhänge, forschte. Sie brauchte dauernd Ansprache und Input. Und sie war von Beginn an sehr, sehr sensibel. Böse Zungen nennen solche Kinder gerne „Heulsusen“. Fakt ist: Sie empfand sehr viel. Gerüche, Laute, Geschichten, Gefühle an sich (Hochsensibilität – ja, das kann man so nennen. Wir respektieren dies und sorgen dafür, dass es ihr damit soweit gut geht.). Alles war immer „totaaal schmerzhaft“, trat ihr jemand auf den Fuß, so war es „mit voller Absicht!“, kam jemand in einer Geschichte zu kurz oder starb sogar eine Figur, konnte sie wochenlang darüber sehr traurig sein. Sie weinte sehr, sehr viel.
Während der Opa dies manchmal genervt mit „Bitte, Kind, stell doch mal deine Sirene ab“ kommentierte, nahm ich es seufzend (aber nicht weniger genervt) hin. Ich verstand: So ist das Kind nun mal. Aber es strengt natürlich an, wenn jemand viel weint. Und laut. Und vor allem nach jedem schönen Ausflug im Auto zu meckern und zu heulen. Ich habe gerne gesagt: „Being sad is her happiness“: Waren es zu viele gute Eindrücke gewesen, brauchte sie ein Gegengewicht, um wieder in Balance zu kommen. Sich frei entfaltende, vertrauensvolle Persönlichkeiten zeigen eben auch sehr viele Charaktereigenschaften. Diese sind für das Umfeld nicht immer einfach zu „ertragen“. Bedürfnisse kollidieren nun mal. Und umso öfter, je mehr Familienmitglieder da sind. Der eigene Raum wird zwangsläufig kleiner – viele Geschwister zu haben ist ein sehr natürlicher Zustand, in dem man sich selbst gut zu regulieren lernt. Das macht es aber nicht unbedingt entspannt und einfach für den oder die Einzelne/n
Nummer 1 „kochte ihr eigenes Süppchen“, war in sich zufrieden und eher introvertiert. Gemeinsam aber drehten sie jedoch auf und tauchten tief in Fantasiewelten ab. Hierbei habe ich sie niemals gestört, sondern mich immer danach gerichtet, dass sie diese herrliche Zeit voll auskosten können. (Aber wehe, ich hatte einen Telefonhörer in der Hand! Dann ließen sie alles fallen und suchten mich auf, um Bedürfnisse zu äußern. Habe das Telefonieren damals aufgegeben.)
Beide waren noch nicht im Kindergarten. Das änderte sich mit unserem Umzug, als Nummer 3 geboren wurde und das Studium meines Mannes beendet war:
Die beiden waren fünf, beziehungsweise 3 Jahre alt als Nummer 3 geboren wurde und etwas später kamen die beiden Großen in den Kindergarten.

Auch dieses Mal wurde das kleine Wesen herzlich von den Größeren aufgenommen. Nur Nummer 2 zeigte Spuren von Eifersucht. Nummer 1, die „Erhalterin der Systeme“, wie wir sie gerne nennen, ging sofort auf in ihrer neuen Rolle als zweifache große Schwester.
Nummer 3 war ein Anfänger-Baby: Schlief wunderbar, brüllte niemals und sah sich tatsächlich zufrieden um, wenn sie auf einer Decke lag. Das kannte ich noch nicht: Die beiden ersten waren fordernder gewesen, ließen sich ungern ablegen. Nummer 3 schien ihre ganz eigene Weisheit mit zu uns gebracht zu haben und unser Job war wirklich eher klassisches Begleiten mit ab und an ein paar Hinweisen.
Sie liebte Selbstständigkeit, sprach mit zweieinhalb Jahren bereits ganze Sätze mit langen Nebensätzen und kletterte in unseren Apfelbaum. Auch hier ließ ich sie ihre Fähigkeiten ganz kennenlernen. Ihre Körperbeherrschung war erstaunlich. Sie redete bald ununterbrochen. Philosophierte über Gott und stellte allerlei erstaunliche Fragen, die beantwortet werden wollten. Sie brauchte viel Nähe und ein offenes Ohr, sowie viele Antworten.
Ich vermied Strafen, regte positiv an, kommunizierte gewaltfrei (und viel). Ich hielt mich an den wunderbaren Grundsatz, dass man für keine Information zu jung oder zu klein sein kann – sie muss eben nur entwicklungsgerecht mitgeteilt werden. Ich war und bin überzeugt, dass man den kindlichen Gehirn weit mehr „zumuten“ kann, als man im ersten Moment denkt. So erfuhren unsere Kinder nicht nur viele Fremdworte, sondern vor allem auch viele Zusammenhänge. Ganz gleich aus welchen Bereich: Literatur, Kunst, Geschichte, Politik, Sprachen … sie interessierten sich für alles Mögliche und erhielten sehr viele geistige Anregungen.
Nummer 2 erging sich weiterhin darin, sehr viel zu empfinden und dies deutlich auszudrücken. Sie weinte immer noch quasi andauernd. Und ich tröstete sie geduldig. Ab und an wurde mir das zu viel, aber ich fand, es sei wohl sehr inkonsequent, plötzlich nicht mehr die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und richtig zu behandeln, nur, weil es nun drei kleine Kinder im Haus waren, um die ich mich überwiegend alleine kümmerte.
Ich wollte vermeiden, dass Nummer 2 ein klassisches Sandwich-Kind werden würde – mit all den Repressalien, die das bekanntlich für ein Kind mit sich bringt. Also bekam sie sehr viel Aufmerksamkeit.
An dieser Stelle mag dem oder der einen oder anderen LeserIn der Gedanke kommen: „Puh, das klingt aber anstrengend: Drei so unterschiedliche Persönlichkeiten wahrzunehmen und deren Bedürfnisse aufzufassen und umzusetzen. Und irgendwie klingt es so, als käme die Mutter selber irgendwann etwas zu kurz“
Exakt. Beides.
Die Mutter, das Individuum
Es ist so: Man hat doch ein gewisses Kontingent an eigener Energie. Diese entstammt der Grundenergie und der, die man generiert. Um sie zu generieren braucht man verschiedene Dinge (Maslowsche Bedürfnispyramide und so), auf die man achten sollte: Die eigenen Bedürfnisse. Bei nur einem oder zwei Kindern funktioniert das gut. Meine Erfahrung zeigt, dass es ab drei Kindern etwas haarig wird.
Ich bin nämlich auch ein Individuum mit Bedürfnissen, die Essen, Duschen und Schlafen übersteigen. In meinem Fall gab es da noch eine traumatische Kindheit mit all ihren Auswirkungen zu verarbeiten.

Dies alles zusammen war zu viel.
Dennoch waren meine Kinder das Niveau der Bedürfnis- und Persönlichkeitswahrnehmung gewohnt. Ich konnte es ihnen schlecht entziehen oder einschränken, ohne negativen Einfluss auf sie zu nehmen.
Man kann sich dieses hohe Level an Energieausgabe jedoch nur leisten, wenn man viel Kontingent hat: Familienmitglieder, die helfen. Oder schöne Hobbies. Oder eine recht unbeschwerte Biographie. Wenn man nichts davon hat, wird auf Dauer die Freude über die Kinder nicht ausreichen, um das nötige Energielevel aufrecht zu erhalten.
Ich merkte es zunächst nicht: Die Jahre vergingen und die Kinder waren glücklich. Ich war glücklich. Ich war müde und auch manchmal erschöpft und oft echt auch genervt. Aber meine Mädels sich entwickeln zu sehen war für mich ganz herrlich. Ich bekam nicht mit, wie viel Energie es mich kostete, mich weitaus mehr um andere Menschen als um mich selbst zu kümmern. Und ich hielt meine Bedürfnisse klein mit den klassischen Gedanken, dass dies eben normal sei, wenn man Kinder hat. Dass Mütter sich eben hintenanstellen, was nicht mal bravourös, sondern erwartenswert sei et cetera.
Ich hatte neben meiner Freude an der eigenen Familie eine mich dauernd kritisierende Schwiegerfamilie. Ich war einfach nicht gut genug, egal, was ich tat. Und ich tat daher immer mehr. Ich hatte doch bereits keine liebevollen leiblichen Eltern – da hätte ich so gerne ein Ersatz-Nest gehabt. Leider konnte mich dieses potentielle Nest nicht leiden und schob mich, das unerwünschte Kuckuckskind, dauernd an den Nestrand. Die Atmosphäre war vergiftet, übergriffig und anstrengend.
Und das kostete vielleicht Energie! Diese musste ich aber auch aus dem Glück mit den Kindern ziehen. Ich begann das zu tun, was viele Mütter tun: Ich sublimierte eigene Bedürfnisse durch die Erfüllung der kindlichen Bedürfnisse. Soll heißen: Ich brauchte Zuspruch und Liebe. Und gab beides den Kindern. Um aus deren Freude und Sicherheit beides auch für mich zu ziehen. Das ist so, als würde man sich am eigenen Zopf aus dem Matsch ziehen. Oder seinen eigenen Atem aus einer Tüte atmen: Das geht nur bedingt gut.
Ich wollte mir etwas Schönes gönnen, so aus immer wieder aufflammender Selbstliebe. Und kaufte wieder nur etwas für die Kinder. Mit der Post-Partum-Figur waren Umkleidekabinen eh ein Gräuel und süße Kinderkleidchen passen den Kleinen immer perfekt!
Hatte ich eine Praline in der Hand, guckte Nummer 1 mir neidisch darauf und ich fühlte mich sofort egoistisch. Ich gab sie ihr. Nummer 1 hatte bereits als Baby blitzschnell in meinen kauenden Mund gefasst und mein Essen herausgenommen, um es selber zu verschlingen. Ehrlich wahr. Ich dachte: „Es ist ja nur Essen, die Kinder freuen sich mehr darüber. Ihnen ist das wichtiger als mir.“
Darauf folgten:
„Es ist ja nur eine Ruhepause, die Kinder brauchen mich aber bestimmt sehr dringend. Ich muss auch nicht dauernd nur ‚rumliegen!“
„Es ist ja nur ein Toilettenbesuch und kein Wellnesstag. Dann bin ich eben gestresst. Sie wissen es ja nicht besser.“
„Es ist ja nur ein seltenes Telefonat mit der Freundin und ich schließe mich auf dem Klo ein, um es zu Ende zu führen, während sie an der Tür hämmern. Aber man muss ja auch nicht dauernd labern.“
Ob ich manchmal wütend geworden bin? Oh ja, natürlich. Ich habe gezeigt, wenn es mir zu bunt wurde. Angebrüllt habe ich sie jedoch nicht. Ich bin manchmal lauter geworden und habe mich hinterher wie eine Versagerin in puncto Selbstbeherrschung gefühlt. Insgesamt war ich aber sehr, sehr langmütig. Und diszipliniert.
Als sie größer waren und gemeinsam ein Stündchen spielen konnten, begann ich wieder zu zeichnen. Das war mein Hobby. Ich zeichnete Comics. Von sexy Vampiren, die frei von Moral die Nacht besaßen. Hach. Das tat gut, so mitten zwischen Kleinkindkotze und den auf einen klapperigen Ständer balancierten Wäschebergen.
Aber es ging ja vermutlich allen Müttern so. Das hörte und las man ja. Also war es vermutlich der normale Lauf der Dinge. Man gab von seinen Bedürfnissen erstmal fast alle weg. Weil sie nicht so wichtig sind. Die Kinder gehen vor. Und sie sind der Quelle der Freude, der Energie und zugleich das tiefe Loch, in dem sie wieder verschwindet. Wer seine Freude nicht aus den Kindern zieht und dauernd glücklich ist, ist eine miese Mutter – so lernt man das schließlich.
Als Nummer 3 neun Monate alt war begann ich freiberuflich als Texterin zu arbeiten. Das tat mir sehr gut. Inhaltlich und auch wegen des Geldes. Ich hasse das Gefühl von Abhängigkeit nämlich. Unabhängigkeit ist eines meiner Bedürfnisse.
Ich war ganz erstaunt, dies festzustellen. Zugleich gestand ich mir nicht ein – da ich mein Bild von mir als Powerfrau zum Durchhalten so dringend brauchte – dass ich wirklich zu viel leistete.
Zudem hatte ich inzwischen- durch den Entzug derselben – weitere Bedürfnisse an mir festgestellt.
Nun aber war ich in meinem eigenen System gefangen und ich konnte sie kaum erfüllen. Ich liebte es eigentlich, mich in Ruhe zu schminken und gut anzuziehen. Ich quatschte eigentlich gern ausgiebig und ungestört mit Gleichaltrigen. Ich hatte eigentlich gerne Zeit für Kunst, Literatur, ein bisschen Schneiderei, ein Gläschen Wein, einen Einkaufsbummel, guten Sex. Eigentlich hatte ich eine Menge Fernweh und interessierte mich für fremde Länder und deren Geschichte. Ich liebte es eigentlich, allein zu sein. Ich mochte keine Fremdbestimmung. All das waren Merkmale meiner eigenen Persönlichkeit, die sich nicht komplett verändert, weil man Kinder bekommt.
Doof gelaufen.
Wie das Ganze für die Kinder und für mich weiterging? Und was die Kinder inzwischen selber über diesen Umgang mit ihnen sagen?
Das erfahrt Ihr bald in Teil 2

